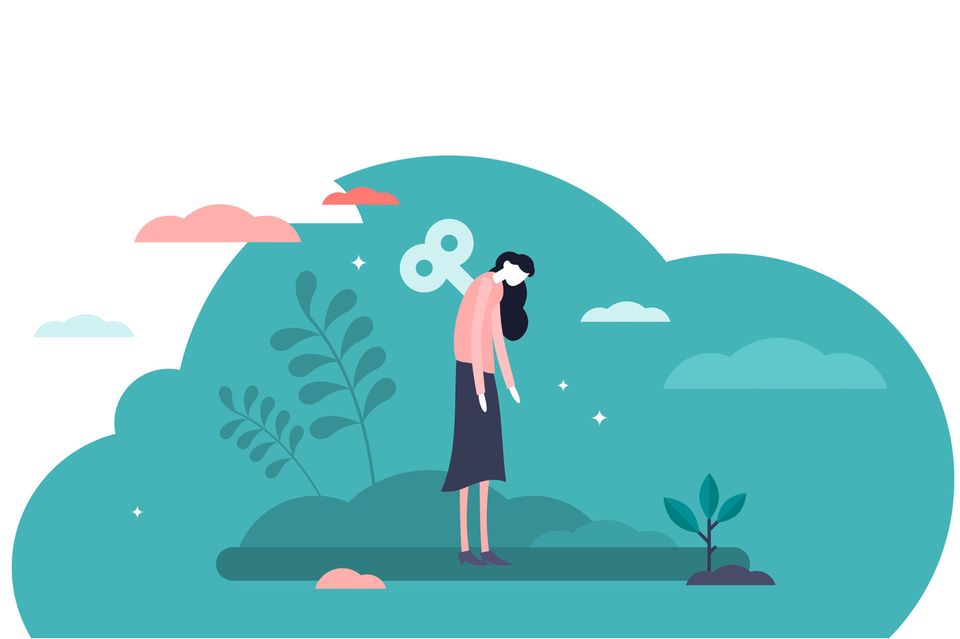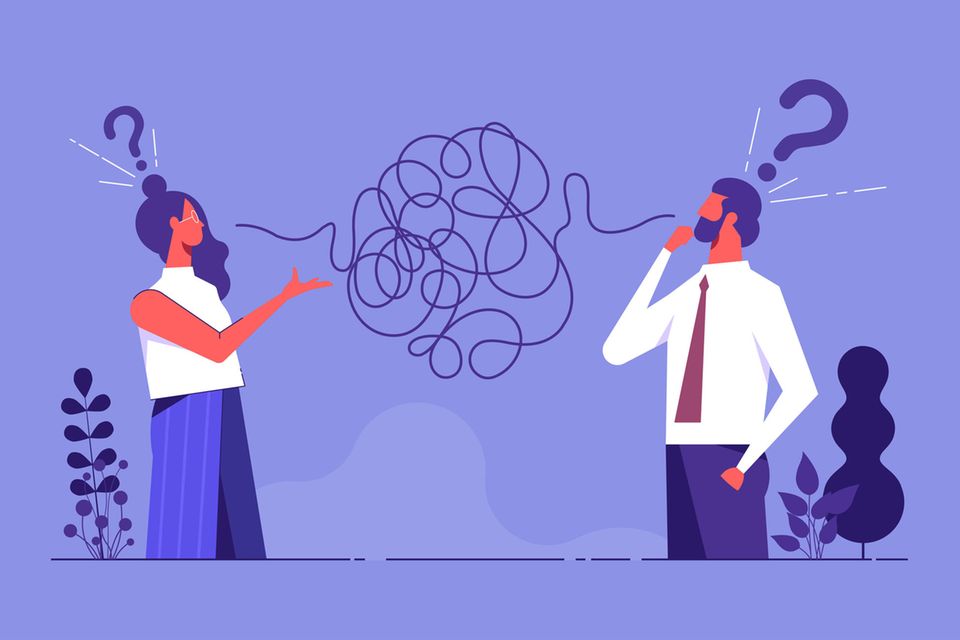Alle machen Fehler, niemand ist perfekt und Makel und Schwächen sind total menschlich und sympathisch – weiß jeder. Trotzdem versuchen viele Menschen, Fehler um jeden Preis zu vermeiden, sich selbst zu optimieren und ihre Schwächen zu verbergen. Aber warum? Warum stellen einige Leute so hohe Ansprüche an sich, dass sie sie nicht erfüllen können und sich deshalb nie zufrieden und gut genug fühlen? Warum leiden so viele Menschen unter Perfektionismus, wenn Perfektion weder erreichbar noch erstrebenswert ist?
Fragen über Fragen – mit denen wir uns hier beschäftigen werden. Dabei gehen wir den psychologischen und gesellschaftlichen Ursachen des Perfektionswahns auf den Grund und schauen auf die Folgen, die er für Betroffene haben kann. Außerdem geben wir Tipps, wie du als perfektionistischer Mensch deine Ansprüche auf ein angemessenes Maß herunterfahren kannst. Ready? Na dann set und go!
Was ist Perfektionismus?
Psychologen beschreiben mit dem Begriff Perfektionismus grundsätzlich ein übertriebenes Streben nach Perfektion und/ oder Fehlervermeidung. Dabei unterscheiden sie zwischen zwei möglichen Ausprägungen, und zwar:
- perfektionistischem Streben, d. h. dem Versuch und der Anstrengung, möglichst makellos zu sein und Aufgaben perfekt auszuführen, und
- perfektionistischer Besorgnis, d. h. einer überzogenen Angst vor Fehlern.
Während perfektionistisches Streben typisch für Menschen ist, bei denen im sogenannten "Big Five"-Modell die Eigenschaft Gewissenhaftigkeit überdurchschnittlich stark ausgeprägt ist, bringen Experten perfektionistische Besorgnis mit einem hohen Maß an Neurotizismus in Verbindung, also einer psychischen Instabilität und einem geringen Selbstwertgefühl (weitere Infos findest du in unserem Artikel über das Big Five-Modell). Dabei wird perfektionistisches Streben in erster Linie als intrinsisch motiviert eingeordnet, also von den eigenen Werten und persönlichen Ansprüchen getrieben, perfektionistische Besorgnis gilt dagegen als extrinsisch motiviert, d. h. die Wahrnehmung und Sichtweise anderer Menschen steht im Vordergrund.
Gibt es guten und schlechten Perfektionismus?
Auf den ersten Blick erscheint perfektionistisches Streben vielleicht als gar nicht so schlimm oder zumindest als die "bessere" Seite des Perfektionswahns – denn was ist schon verkehrt daran, sorgfältig und gewissenhaft zu handeln? Tatsächlich gilt oder galt Perfektionismus deshalb zum Teil sogar als Stärke und nicht als Problem. Doch wie bei Salz in der Suppe entscheidet die Dosierung, ob es uns nützt oder schadet. Übertriebene Sorgfalt kann schnell dazu führen, dass wir uns beispielsweise an kleinen Details viel zu lange aufhalten oder gute und objektiv betrachtet völlig zufriedenstellende Ergebnisse verwerfen, weil sie uns nicht "perfekt" genug erscheinen.
Außerdem gehen perfektionistische Besorgnis und perfektionistisches Streben bei vielen Betroffenen Hand in Hand und können sich sogar gegenseitig bedingen: Wer sich selbst darauf konditioniert, übermäßig großen Wert auf Sorgfalt und Perfektion zu legen, gewöhnt sich daran und entwickelt automatisch eine überzogene Angst vor Fehlern.
Insofern ist es eher schwierig von "gutem" und "schlechtem" Perfektionismus zu sprechen, zumal Psychologen damit grundsätzlich eine Übertreibung und eine verzerrte Wahrnehmung und Bewertung der Wirklichkeit bezeichnen – entscheidender ist außerdem der Grad, wie stark unsere perfektionistischen Züge tatsächlich ausgeprägt sind ...
Perfektionismus: Wie viel ist zu viel?
Das Fiese ist nämlich: Die Neigung oder Tendenz zum Perfektionismus schlummert grundsätzlich in uns allen – schließlich sind die Big Five als die Eigenschaften definiert, die alle Menschen auszeichnen. Jeder Mensch ist in einem bestimmten Maße gewissenhaft und psychisch unausgeglichen. Das Verrückte dabei: Genau die Eigenschaften, die uns zu krankhaften, sich selbst im Weg stehenden Perfektionisten werden lassen, machen uns in einer niedrigeren Dosis zu fleißigen, gewissenhaften, selbstreflektierten Menschen – aber wo genau liegt die Grenze?
Scharf abstecken lässt sich die zwar nicht und sicherlich verläuft sie auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Doch folgende Anzeichen sprechen dafür, dass die grundsätzliche perfektionistische Veranlagung das gesunde Maß überschritten hat und (mindestens) für den Betroffenen ein psychologisches Problem darstellt.
10 Anzeichen, dass dein Perfektionismus toxisch ist
- Du verlierst dich in Details und brauchst deshalb für viele Dinge länger als geplant.
- Du scheust dich vor Entscheidungen – vor allem, wenn du dich dabei auf dein Bauchgefühl verlassen musst.
- Du bist nie mit dir und deinen Leistungen zufrieden.
- Du hast große Angst vor Herausforderungen und vermeidest es lieber, spontan neue Aufgaben zu übernehmen.
- Da kannst kein Lob annehmen.
- Dir fällt es schwer, etwas zu Ende zu bringen.
- Du rechnest stets mit negativer Kritik.
- Du ärgerst dich extrem über Fehler – sowohl über deine eigenen als auch die von anderen.
- Wenn du scheiterst oder "versagst", fühlst du dich wertlos.
- Du fühlst dich oft ausgebrannt und erschöpft oder fragst dich, wie lange du noch durchhalten kannst.
Wenn die Hälfte oder mehr der genannten Aussagen auf dich zutreffen, stellt Perfektionismus in deinem Leben mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem dar – und du solltest dich am besten einmal fragen, warum.
Gründe für Perfektionismus
Theoretisch könnten wir also alle Perfektionisten sein, praktisch sind wir es aber nicht. Doch welche Faktoren begünstigen einen ausgeprägten toxischen Perfektionismus? Am häufigsten werden folgende aufgeführt.
1. Veranlagung
Schon von Geburt an sind alle Menschen unterschiedlich und so ist bei manchen der Hang zum Perfektionismus von Anfang an stärker ausgeprägt als bei anderen. Wer generell zum Grübeln neigt und sich schwer damit tut etwas loszulassen, tendiert auch öfter zu perfektionistischen Sicht- und Verhaltensweisen als eine Person, die gerne macht und ausprobiert und wenig Probleme damit hat, einen Schlussstrich zu ziehen und sich etwas Neuem zu öffnen.
2. Erziehung
Unsere Eltern bzw. das soziale Umfeld während unserer Kindheit prägen in hohem Maße unsere Werte und Denkmuster. Wenn sie uns vermitteln, dass es schlimm ist Fehler zu machen und man immer 110 Prozent geben muss, um ein gutes Gewissen haben zu dürfen, wird das eine perfektionistische Einstellung mit Sicherheit fördern.
3. Gesellschaft
Wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Schon in der Schule müssen wir uns bewerten und mit anderen messen lassen. Wer herausragt – z. B. durch ein außergewöhnliches Talent, Aussehen oder einen extrem steilen Karriereweg – wird mit Respekt, Bewunderung und Macht überhäuft. Natürlich fördert das ein Streben nach Extremen und die Auffassung, Durchschnitt und Mittelmaß seien minderwertig.
4. Selbstwertgefühl
Bei den meisten Perfektionisten liegt ihrem Perfektionszwang ein gestörtes Selbstwertgefühl zugrunde. Sie definieren sich über ihre Leistungen und glauben, sich ihren Platz auf dieser Welt durch überdurchschnittlich hohen Einsatz verdienen zu müssen. Natürlich hat dieser Mangel an Selbstvertrauen häufig mit den zuvor genannten Faktoren Veranlagung, Erziehung und Gesellschaft zu tun, doch genauso können auch individuelle Erlebnisse wie eine toxische Beziehung oder Ausgrenzung während der Schulzeit das Selbstwertgefühl nachhaltig schädigen.

Folgen von Perfektionismus
Ein leichter Perfektionismus lässt sich oftmals gut bewältigen und in bestimmten Umständen sogar konstruktiv nutzen – insbesondere wenn den Betroffenen bewusst ist, dass sie perfektionistisch veranlagt sind, und sie damit reflektiert umgehen. Eine überdurchschnittlich große Gewissenhaftigkeit und Liebe zum Detail kann zum Beispiel einen Architekten zum Star-Architekten machen oder kleine Fehler in einem Konzept offenbaren, das außer einem Perfektionisten niemals jemand angezweifelt hätte.
Öfter hat Perfektionismus jedoch negative Folgen, insbesondere für die Betroffenen. Der ständige Druck, besser sein oder bessere Leistungen bringen zu wollen, verursacht Stress. Kombiniert mit dem dauerhaften Frust darüber, nicht gut genug zu sein und zu versagen, kann Perfektionismus zum Teil schwere psychische Störungen begünstigen. Folgende Probleme und Krankheiten treten bei Perfektionisten statistisch gesehen gehäuft auf.
- Verminderte Produktivität
- Depression
- Essstörungen
- Angststörungen
- Zwangsstörungen
- Burnout
- Suizidgedanken
So kannst du dich von Perfektionismus befreien
Um Perfektionismus zu überwinden, ist der erste und wichtigste Schritt, ihn als Problem zu erkennen und bereit zu sein, die eigene Wahrnehmung und Einstellung zunächst regelmäßig und gezielt zu hinterfragen und dann allmählich zu "perfektionieren" 😉. Das beinhaltet Gewohnheiten ändern, Ängste überwinden, Gefühle verstehen, Selbstfindung und all den anderen Kram, für den ein einziges Leben eigentlich kaum ausreicht. Welche konkreten Maßnahmen du ergreifen kannst, um toxischem Perfektionismus den Kampf anzusagen, verraten wir jetzt.
8 Tipps, wie du deinen Perfektionismus überwinden kannst
1. (Knappe) Deadlines setzen
Um zu lernen, dich weniger in kleinen Details zu verlieren, kannst du dir bei bestimmten Aufgaben gezielt eher knapp bemessene Deadlines setzen, zu denen du sie abgeschlossen haben möchtest. Du wirst sehen: Sehr oft macht es gar keinen großen Unterschied, ob du noch eine Stunde lang an etwas feilst oder es lässt. Wenn du eine Deadline eingehalten hast, kannst du dich dafür belohnen, indem du die Zeit für einen schönen Spaziergang nutzt oder dir eine Maniküre gönnst o. Ä.. Fang am besten mit harmlosen, alltäglichen und nicht besonders beängstigenden und stressbesetzten Aufgaben an.
2. Mut zur Lücke finden
Such dir eine Tätigkeit aus, die du regelmäßig auf die gleiche Art und Weise ausführst, und lass dabei eine Kleinigkeit weg, z. B. bei einer E-Mail ein zweites Mal drüberlesen, eine Rechnung ein drittes Mal nachrechnen oder etwas Ähnliches dieser Art. Vielleicht kannst du auch eine Aufgabe im Haushalt probeweise nur jeden zweiten Tag erledigen statt täglich. Achte dann mal darauf, ob die Welt davon untergeht. Wenn nicht, war deine Sorgfalt wahrscheinlich übertrieben und verschwendete Energie.
3. Priorisieren lernen
Du musst deine Ansprüche an Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit ja nicht komplett und überall über Bord werfen – doch du solltest lernen, sie da anzubringen, wo es sich lohnt, und das große Ganze im Blick behalten. E-Mails stundenlang gegenzulesen ist in der Regel absolut nicht nötig und steht in keinem Verhältnis zum Nutzen – wenn der Empfänger sie sowieso mit halber Aufmerksamkeit unterm Tisch während eines Meetings liest.
4. Dich mit Fehlern anfreunden
Es ist nun mal so: Fehler sind einfach gut. Klar dürfen wir uns über sie ärgern und sie doof finden, schließlich ist das der Grund dafür, dass wir daraus lernen und statt den alten neue Fehler machen können. Doch Angst vor Fehlern lähmt uns und schränkt uns in unserer Freiheit und Entfaltung ein. Meistens bewerten wir unsere eigenen Fehler viel schlimmer, als andere es tun, und wenn du mal zurückdenkst: Wann hast du mit einem Patzer das letzte Mal eine Katastrophe ausgelöst ...?
5. Dich mit anderen vergleichen
Normalerweise raten wir dringend davon ab, sich mit anderen zu vergleichen, schließlich sind wir alle einzigartig und sollten das auch feiern und genießen. Allerdings haben Perfektionisten oftmals so hohe, überzogene Ansprüche an sich selbst, dass ein Blick nach links und rechts sie zurück in die Realität holen kann. Wichtig: Wenn du dich vergleichst, schau bitte auf den Durchschnitt und nicht auf Überflieger oder Experten.
6. Feedback annehmen
Statt dich immer nur an deinen eigenen Ansprüchen zu orientieren, lerne darauf zu vertrauen, wie andere dich einschätzen. Wie beurteilen dich deine Freundinnen oder vielleicht auch Vorgesetzte? Hör dir an, was sie zu sagen haben, und glaube ihnen, wenn sie dir ein gutes Zeugnis ausstellen.
7. Stolz auf dich sein lernen
Tja, sorry, aber wenn du unter Perfektionismus leidest, wirst du wohl oder übel Selbstliebe lernen und dein Selbstwertgefühl stärken müssen. Blöderweise sind das oft ziemlich langwierige Prozesse, doch einen Anfang kannst du zum Beispiel machen, indem du lernst, stolz auf dich zu sein. Was magst du an dir? Worin bist du gut? Was ist dir heute gut gelungen? Gewöhne dir doch mal an, jeden Abend eine Sache aufzuschreiben, auf die du stolz bist – und das kann auch so etwas sein, wie dass du auf eine E-Mail prompt geantwortet hast, ohne drei Mal drüber zu lesen und nachzudenken.
8. Hilfe suchen
Wie gesagt: Perfektionismus kann ernsthafte Krankheiten nach sich ziehen. Wenn du dich von deinen eigenen Ansprüchen so überfordert fühlst, dass du keinen Ausweg aus dem Teufelskreis mehr siehst, ist es sinnvoll, professionelle Hilfe bei einem Therapeuten zu suchen.