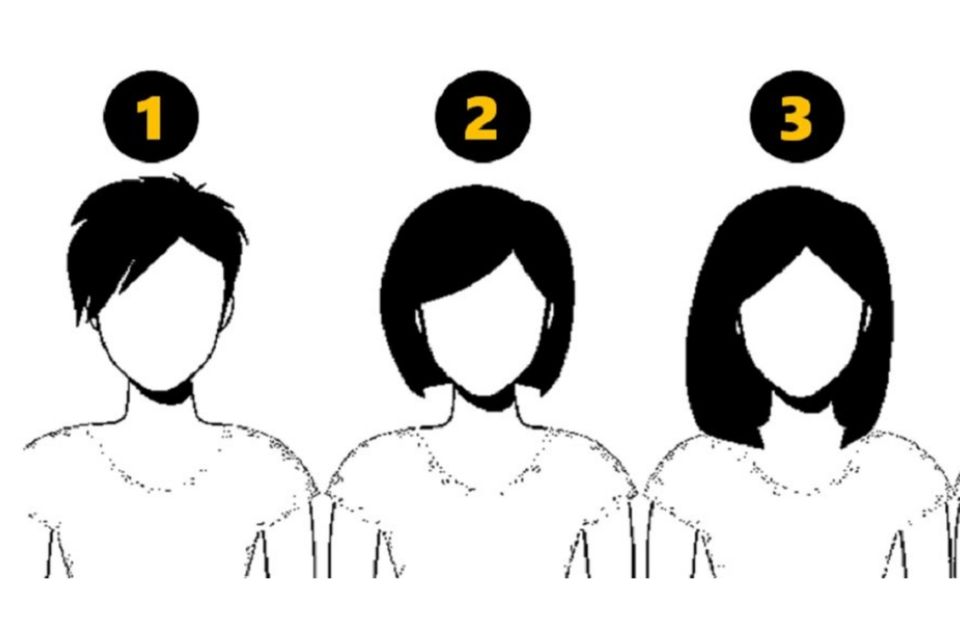Wer sich gerne mit Pop-Psychologie und "Wie verbessere ich mein Leben?"-Ratgebern beschäftigt (so wie ich), hat sicherlich schon mal irgendwo gelesen oder gehört, dass Dankbarkeit glücklich machen soll. Dankbare Menschen, so fasst Wikipedia den aktuellen Forschungsstand zusammen,
- sind zufriedener mit ihrem Leben und ihren Beziehungen,
- leiden weniger unter Stress,
- haben ihre Umgebung, ihr persönliches Wachstum, Lebenssinn und Selbstwertgefühl besser unter Kontrolle,
- können besser mit Problemen umgehen,
- tun sich leichter, andere um Hilfe zu bitten,
- leiden weniger unter Schuldgefühlen,
- haben einen geringeren Hang zum Drogenmissbrauch
- und schlafen besser.
Wer möchte da Bitteschön kein dankbarer Mensch sein? Ich jedenfalls wollte einer sein! Doch um einer zu werden, musste ich etwas ändern – denn dass ich in mir eine grundlegende, naturgegebene Dankbarkeit gespürt hätte, kann ich nicht gerade behaupten.
Die Ausgangslage
Natürlich habe ich mich bei anderen bedankt, wenn sie etwas für mich getan haben. "Danke für das Salz", "vielen Dank für Ihre Antwort", "1.000 Dank für diese tolle Geburtstagsüberraschung!!!" – ich weiß schließlich, was sich gehört, und schätze es sehr, wenn jemand nett zu mir ist. Außerdem habe ich immer Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern empfunden. Dass sie stets für mich da waren und hinter mir standen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, ist einfach unfassbar. Aber davon abgesehen – warum sollte ich mich dankbar fühlen? Naja, zum Beispiel, um besser mit Problemen klarzukommen ...
Laut Lifecoaches, Therapeuten, psychologischen Studien und diversen anderen Quellen können wir tatsächlich lernen, dankbarer zu werden, indem wir unser Gehirn gezielt trainieren. Langfristig am wirksamsten sei, so legen Untersuchungen nahe, ein sogenanntes Dankbarkeitstagebuch, was nichts weiter bedeutet, als jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Lucky me! Da ich sowieso seit ein paar Jahren jeden Abend circa zwei bis drei Minuten Tagebuch schreibe, musste ich nicht einmal meine Routine ändern, sondern mir nur eine zusätzliche Frage stellen:
- Wofür bin ich heute dankbar?
Aller Anfang ist schwer
Am Anfang, daran kann ich mich noch erinnern, fiel es mir schwer, die Dinge einfach so aufzuschreiben, die mir spontan in den Sinn kamen. Ich habe vieles hinterfragt und Gedanken gehabt wie: "Ernsthaft? Ist das nicht etwas banal?" oder "oh Gott, worauf legst du bitte wert? Ist ja deprimierend!". Außerdem konnte ich mich nicht so leicht auf drei Punkte festlegen – bei meinem ersten Eintrag habe ich zum Beispiel sechs aufgelistet (darunter eine Voicemail von meiner Schwester, dass die Kassiererin im Supermarkt nett zu mir war und mein leckeres Frühstück – nur damit klar ist, was ich mit banal meine).
Doch trotz meiner Startschwierigkeiten und obwohl ich mir in der Anfangsphase zum Teil sehr komisch dabei vorkam, mir die Banalitäten meines Alltags vor Augen zu führen und dafür dankbar zu sein, war da von Beginn an auch noch etwas anderes: Ein gutes Gefühl, ein kleiner mood lift, der zuverlässig bei jedem einzelnen Eintrag eintrat. Am Abend noch einmal an die nette Kassiererin zu denken, ließ mich trotz meiner anfänglichen Wertungen und Vorbehalte gegenüber meiner eigenen Wahrnehmung einen Augenblick lang lächeln – zumindest innerlich. Von daher fiel es mir nicht besonders schwer, mit diesem täglichen Dankesritual weiterzumachen.
Von der anfänglichen Überwindung zur Routine
Mit den Wochen fiel es mir immer leichter, mich am Abend für drei Dinge zu entscheiden, für die ich dankbar bin. Statt wie zu Beginn dabei in Gedanken meinen ganzen Tag noch einmal revue passieren zu lassen, ging ich immer mehr dazu über, einfach das aufzuschreiben, was mir in dem Moment in den Sinn kam. Meine Vorbehalte und Zweifel darüber, ob etwas wert war, in meiner Liste zu landen, wurden Woche für Woche weniger. Außerdem – oder vielleicht dadurch?! – veränderte sich das, für das ich dankbar war, zum Teil sehr in seiner Qualität: Neben konkreten Erlebnissen und Dingen tauchten immer öfter generelle und abstrakte Phänomene auf, z. B. "dass ich gesund bin" oder "dass ich frei bin". Genau wie konkrete Erinnerungen lösten auch sie in mir dieses angenehme Gefühl aus, dieses innere Lächeln. Auf einmal musste offenbar nicht einmal mehr etwas passieren, das mich dankbar macht – es genügte, dass alles so war, wie es ist.
Was hat sich verändert?
Mittlerweile führe ich mein Dankbarkeitstagebuch der Alltagsbanalitäten und Abstrakta seit mehr als einem Jahr und halte es für das beste Experiment, das ich je begonnen habe. Es kostet nahezu keine Zeit, bzw. ist zumindest kein zusätzlicher Stressfaktor im Alltag, hat mich aber definitiv positiv verändert.
Tatsächlich kann ich hinter die meisten der eingangs aufgelisteten Punkte ein Häkchen setzen: Ich bin heute zufriedener als vor zwei Jahren, gehe besser mit Problemen um, leide weniger unter Stress und Schuldgefühlen und fühle mich weniger abhängig und ausgeliefert. Ob sich all das allein auf mein Dankbarkeitstraining zurückführen lässt, wage ich allerdings zu bezweifeln – schließlich hat sich in meinem Leben noch einiges mehr getan.
Ich bin älter geworden, habe Erfahrungen gesammelt, kleine und große Krisen gemeistert und einige meiner größten Ängsten überwunden. Natürlich bin ich dadurch freier, selbstbewusster und souveräner im Umgang mit Problemen und Konflikten geworden. Meine Dankbarkeitsroutine stand dieser Entwicklung sicher nicht im Wege, aber ob sie sie gefördert hat, kann ich schwer einschätzen – denn dafür müsste ich die Zeit zurückdrehen und noch einmal ohne Dankbarkeit verbringen.
Was ich jedoch in erster Linie meinem Dankbarkeitstraining zuschreibe, ist eine veränderte Grundhaltung zum Leben, eine generell positivere Lebenseinstellung. Ich war zwar noch nie ein miesepetriger Grummel, aber heute sehe ich in nahezu jedem und allem etwas Gutes. Wenn ich mir mein Gehirn wie ein Wirrwarr aus möglichen Wegen vorstelle, scheint mir in meinem der mit dem Schild "positiv denken" der meist befahrene zu sein und der, den ich grundsätzlich als erstes einschlage.

Außerdem ist Dankbarkeit für mich von einer situationsbezogenen Emotion zu einem Grundgefühl geworden. Mir jeden Abend all das vor Augen zu führen, was ich habe – von meiner lieben Freundin Kimi, die in meinem Tagebuch immer wieder auftaucht, weil ich mit ihr so viele schöne Momente erlebe, bis hin zu meiner geistigen Freiheit – macht mir bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann. Das Leben ist nicht immer schön, aber es ist ein Geschenk, für das ich uneingeschränkt dankbar bin.
Ob ich, um mir dieses Gefühl zu bewahren, mein Dankbarkeitstagebuch überhaupt noch fortführen muss, weiß ich nicht. Tun werde ich es aber auf jeden Fall – denn ich gehe gerne mit einem Lächeln ins Bett.