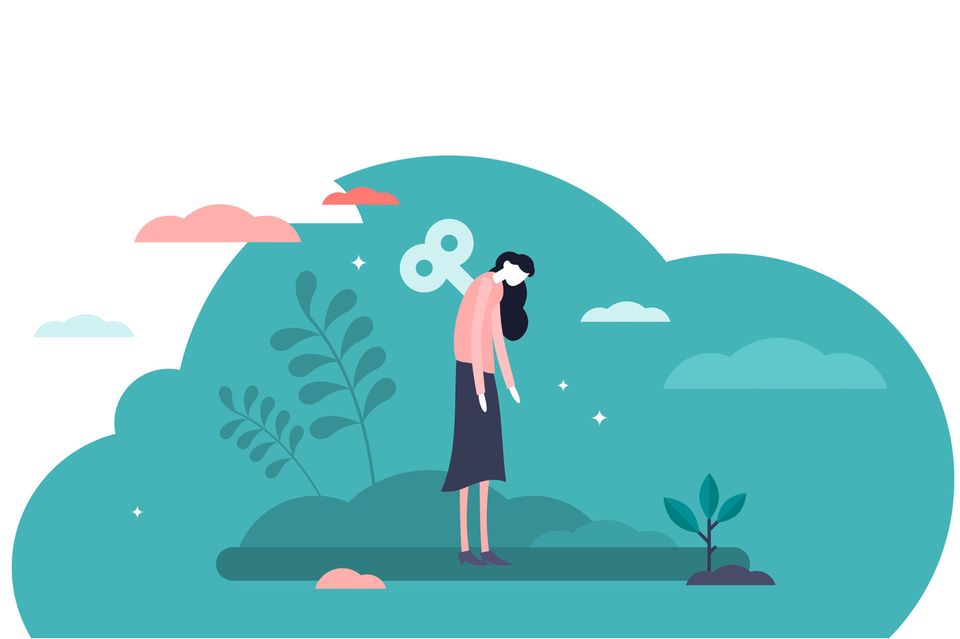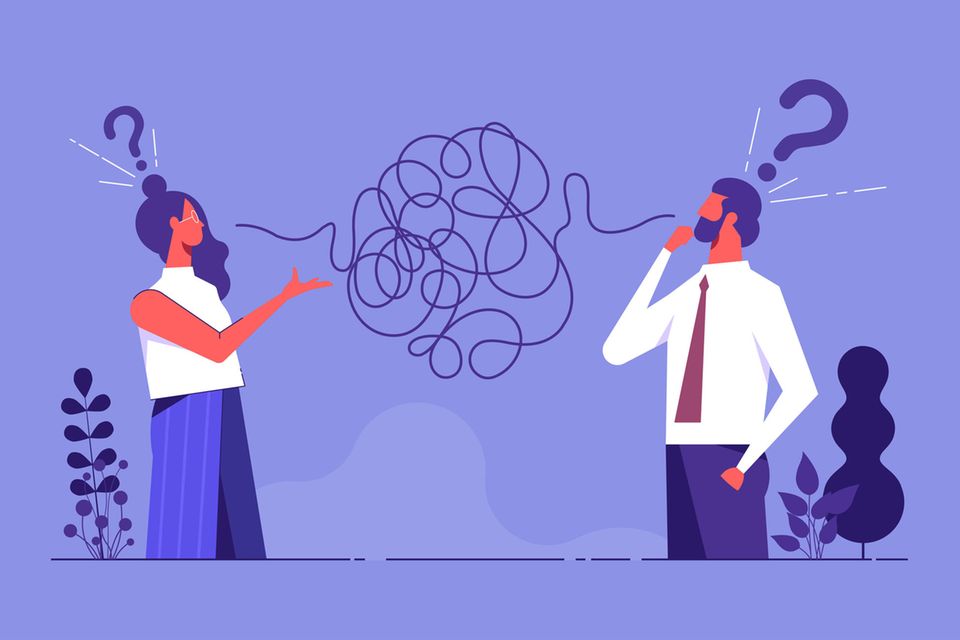Egal ob wir den IQ eines Albert Einstein haben oder den eines Olaf Scholz oder einer Angela Merkel oder einer Meghan Markle, als Menschen sind wir vergleichsweise intelligent – zumindest im Wettbewerb mit den anderen Spezies auf unserer Erde. Jeden Tag stellen wir unsere Intelligenz unter Beweis: Wenn wir miteinander sprechen, wenn wir Verkehrsregeln befolgen oder sie, wann immer es zur Situation passt, brechen, wenn wir den Grund für etwas finden oder ihn wenigstens suchen. Unsere Intelligenz ist die Voraussetzung für unser Denken. Das allerdings ist häufig und oftmals systematisch fehlerhaft. Und zwar egal, ob wir den IQ eines Albert Einstein haben oder den eines Olaf Scholz, einer Angela Merkel oder einer Meghan Markle.
Kognitive Verzerrungen: Systematisches Irren ist menschlich
Kognitionspsycholog:innen sammeln unter dem Begriff kognitive Verzerrung systematische Irrtümer, denen wir in unserem Denken, Wahrnehmen, Urteilen und Bewerten unterliegen. Ein prominentes und für unser Leben recht relevantes Beispiel ist der sogenannte Bestätigungsfehler: Wir neigen dazu, Informationen so zu interpretieren, dass sie uns in unserer Position bestärken. Weitere Beispiele, die teilweise, so behaupten zumindest einige Wissenschaftler:innen, mit dem Bestätigungsfehler zusammenhängen, sind etwa die Denkstrategie, dass wir oft in weitaus höherem Maße von uns auf andere Menschen schließen, als angebracht wäre, oder die Vermutung, dass die meisten Menschen unsere Meinung teilen. Auch der Third-Person-Effekt, der besagt, dass wir die negative Wirkung von Medien auf uns selbst als geringer einschätzen als auf andere Menschen, kann als kognitive Verzerrung mit dem Bestätigungsfehler in Beziehung gesetzt werden: Wir wissen, dass zum Beispiel Werbung einen Einfluss auf Menschen hat. Sonst würde sie schließlich nicht produziert. Allerdings sind wir davon überzeugt, dass wir klug und stabil genug sind, uns nicht beeinflussen zu lassen – also werden es wohl die anderen sein, die manipulierbar sind. Ein letztes Beispiel, da es für den Alltag sehr interessant ist: Tendenziell unterstellen wir unserem Gegenüber in Gesprächen, dass es uns überzeugen möchte, obwohl ihm eigentlich in erster Linie an einem Austausch gelegen ist.
Wieso ist unser Denken so fehlerhaft?
Bislang haben Wissenschaftler:innen mehrere Dutzend kognitive Verzerrungen identifiziert und beschrieben. Einige davon – wie der Bestätigungsfehler – zeigen oder rühren daher, dass wir grundsätzlich unterstellen, unsere persönliche Sichtweise sei vernünftig und eine zuverlässige Referenz, um andere Menschen zu beurteilen. Dabei müssten wir nur einmal den Kontinent wechseln, um feststellen zu können: Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, die Welt zu betrachten. Was wir als Einzelperson wissen und sehen (können), ist ein winzig kleiner Bruchteil dessen, was zu wissen und zu sehen ist. Doch unsere Perspektive und mentale Kapazität sind nun einmal begrenzt. Wir empfinden unser Wissen als viel, weil es für uns tatsächlich viel ist. Und weil es sich für uns besser anfühlt – wären wir uns unserer eigenen Beschränktheit und Unwissenheit ständig bewusst, könnte das unser Selbstwertgefühl schädigen und die Bedeutung unserer Existenz in Frage stellen. Es könnte zu einer Bedrohung für unser Leben werden. Also irren wir uns lieber, wieder und wieder. Ohne es auch nur zu ahnen.
In ähnlicher Weise lassen sich vermutlich für all unsere Denkfehler Erklärungen finden und in einigen können zudem sogar wir, mit unserer verzerrten kognitiven Ausstattung, einen Sinn erkennen. Somit wäre es nicht völlig aus der Luft gegriffen zu sagen: Selbst unsere systematischen Irrtümer sind in gewisser Weise intelligent.
Menschliche Intelligenz hat eine natürliche Funktion
Gerade aktuell, da die künstliche Intelligenz Fortschritte macht und an Relevanz gewinnt, mögen wir uns mit unseren von der Tagesform abhängigen und hormonellen Schwankungen unterworfenen kognitiven Fähigkeiten vielleicht gelegentlich bedroht fühlen. Doch in all ihrer Beschränktheit und Fehlerhaftigkeit haben unsere kognitiven Fähigkeiten und unsere Intelligenz Jahrtausende überdauert und sich in und mit dieser Zeit entwickelt. Es gehört zu unserem Denken, dass wir Ziele und Idealvorstellungen entwerfen – und Fehler und Irrtümer als negativ bewerten. Doch wenn wir unseren Idealen nicht entsprechen, zugleich aber feststellen, dass das, womit wir uns arrangieren müssen, prima funktioniert und seinen Zweck erfüllt, dürfen wir mindestens so zufrieden mit uns sein wie ein Koala oder ein Schmetterling.
Wer davon überzeugt ist, die menschliche Intelligenz sei das größte Wunder des Universums und müsse unbedingt perfektioniert, nachgeahmt oder mit der Herrschaft über die Welten betraut werden, demonstriert damit vielleicht in erster Linie eine Spielart des Bestätigungsfehlers. Auch ein Albert Einstein konnte schlechter denken, wenn er multi-tasken musste, oder könnte nach einem traumatischen Erlebnis Probleme haben, es zu bewältigen. Unsere Intelligenz ist eine für unser Leben und Überleben wichtige und notwendige Eigenschaft. Einerseits tun wir sicherlich gut daran, sie bestmöglich zu hegen und zu pflegen und ja nicht verkümmern zu lassen. Andererseits dürfen wir sie durchaus in all ihren Ausprägungen und mit sämtlichen Schwächen und Fehlern schätzen und bestaunen – und zwar ebenso an uns selbst wie an allen anderen Menschen.
Verwendete Quellen: spektrum.de, ionos.de, Podcast: "Betreutes Fühlen"