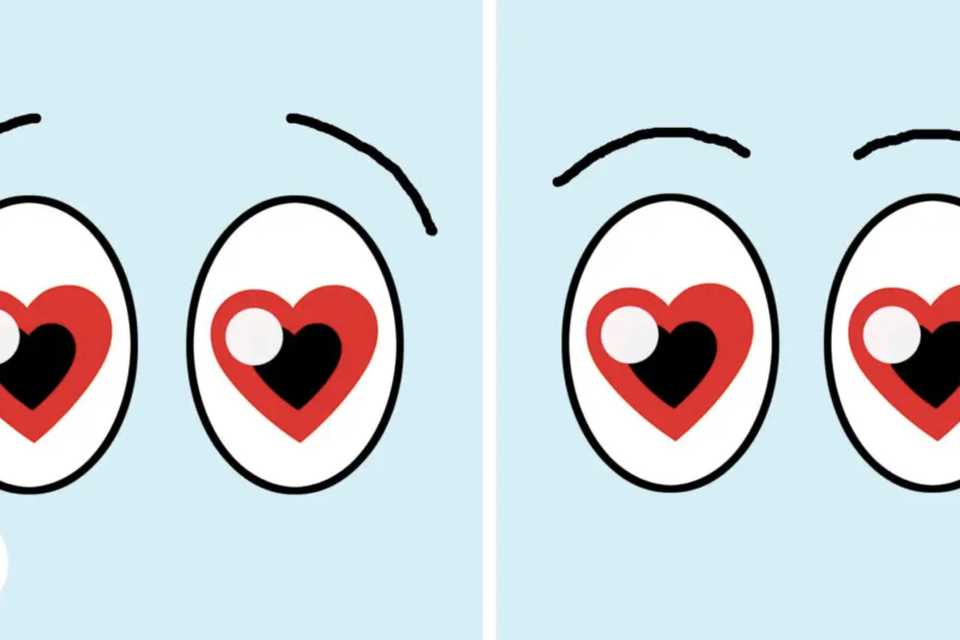Es mag uns nicht immer auf Anhieb einleuchten, doch grundsätzlich helfen uns unsere Gefühle. Ob Freude oder Trauer, Ekel oder Genuss, Neid oder Stolz, unsere Emotionen haben üblicherweise einen Sinn und eine Berechtigung. Und Angst bildet dabei keine Ausnahme.
Eine der grundlegendsten und ursprünglichsten Funktionen von Angst ist, uns bei Gefahren zu alarmieren und unser Leben zu schützen. Wenn wir beispielsweise beim Baden in einem See gerade im Begriff sind, aus dem Wasser zu spazieren, von dort aus jedoch am Ufer eine bedrohlich aussehende Horde Wildschweine ausmachen, wird unsere Angst vermutlich unseren Puls ein wenig in die Höhe treiben, uns den Rat erteilen, lieber noch ein bisschen weiter zu planschen, bis sich die Säue verzogen haben und uns damit vermutlich eine unangenehme Begegnung und ein paar blaue Flecken ersparen. In so einer Situation erfüllt Angst eindeutig ihren Zweck. Allerdings finden wir in unserem Alltag zahlreiche Beispiele, in denen uns Angst nicht so eindeutig nützt. In denen sie eher eine Bürde als ein guter Ratgeber zu sein scheint.
Da wären zum Einen diverse Phobien, mit denen sich einige Menschen herumschlagen. Ob Phobien vor (im mitteleuropäischen Raum) eigentlich harmlosen Tieren wie Spinnen oder Vögeln, Angst vor bestimmten Zahlen oder Berufen (beispielsweise Clowns) oder extrem ausgeprägte Ängste vor engen Räumen, Keimen oder Höhe, die dazu führen, dass Betroffene weder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren noch die erste Etage eines Hauses betreten können. In solchen Fällen lässt sich der jeweiligen Angst kaum eine schützende Wirkung zusprechen.
Zum anderen haben viele Menschen Ängste vor etwas, das im Prinzip gar nicht schlimm ist. Zum Beispiel vor dem Scheitern. Oder vor dem Neinsagen. Oder davor, um Hilfe zu bitten oder sich einer Vertrauensperson zu öffnen. Auch Zukunftsangst kann hinderlich sein und uns ausbremsen oder die Angst vor möglichen Katastrophen und Ereignissen, die wir weder verhindern noch auf die wir uns vorbereiten können. Gewisse konstruktive Botschaften können wir unserer Angst dann möglicherweise entnehmen (in diesem Artikel kannst du nachlesen, welche positiven Effekte Angst haben kann), doch im Zweifel bewahren uns solche Ängste eher vor wichtigen und hilfreichen Erfahrungen als vor Gefahren. Was aber steckt hinter diesen Gefühlen?
"Ängste wie zum Beispiel auch gewisse Phobien, die uns im Alltag tendenziell im Weg stehen und hinderlich sind, sind meist multifaktoral begründet, das heißt, mehrere Einflüsse haben zu ihrer Entstehung und Verstärkung beigetragen", sagt der Psychiater Professor Doktor Andreas Ströhle von der Charité Berlin. Folgende Faktoren sind dabei besonders häufig und relevant.
5 mögliche Gründe für Angst, wenn sie eigentlich fehl am Platz ist
Evolutionäre Prägung
"Typischerweise entwickeln Menschen Phobien eher vor etwas, das zumindest potenziell gefährlich ist", erklärt Andreas Ströhle. So können Spinnen in gewissen Teilen der Welt durchaus mal giftig sein und am Rand einer hohen Klippe ist es wahrscheinlich nicht so sicher wie auf einem solide gebauten Balkon mit Geländer und TÜV-Siegel. Insofern liegt uns eine gewisse Neigung zu Spinnenphobie, Höhenangst und Co. in der Natur – weshalb solcherlei Ängste deutlich verbreiteter sind als die Angst vor kleinen Baby-Kaninchen, grünen Wiesen oder geschmolzenem Käse.
Soziale Prägung und Erziehung
"Was Eltern ihren Kindern vorleben und auch wie sie mit ihnen über ihre Ängste sprechen, hat einen großen Einfluss auf unseren Umgang mit Angst im Erwachsenenleben", sagt der Psychiater. Das bedeutet einerseits, dass sich die Ängste unserer Eltern mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf uns übertragen können.
Wenn zum Beispiel mein Vater um jeden Rauhaardackel einen großen Bogen macht, werde ich den Vierbeinern gegenüber wahrscheinlich ebenfalls ein gewisses Misstrauen entwickeln.
Andererseits kann die Reaktion unserer Eltern auf unsere Ängste einen Einfluss darauf haben, welche Einstellung wir zu dem Gefühl entwickeln. Helfen sie uns, unsere Angst vor dem dunklen Keller abzubauen, indem sie zusammen mit uns hinunter gehen und uns zeigen, dass dort unten gar keine Bedrohung auf uns lauert? Lassen sie uns mit unserer Angst allein und tun sie als dumm und kindisch ab? Oder verstärken sie sie, indem sie sie teilen?
Des Weiteren kann es eine Rolle spielen, wie unsere Eltern vor uns mit ihren eigenen Ängsten umgehen. Leben sie sie hemmungslos aus und hamstern bergeweise Toilettenpapier, wenn mal eine kleine Pandemie ausbricht, oder tun sie, als gäbe es gar keinen Grund zur Sorge, obwohl plötzlich alle Schulen geschlossen sind?
Ob auf die eine oder die andere oder eine völlig andere Weise, unsere Kindheitserfahrungen können unser Angstempfinden beeinflussen und dazu führen, dass wir Ängste entwickeln, die uns eher im Weg stehen als uns nützen beziehungsweise schützen.
Konditionierung
Ähnlich wie wir lernen können, jedes Mal nach dem Zähneputzen ein Glas Wasser trinken zu wollen oder bei einem Signal eine Belohnung zu bekommen, können wir uns an Ängste gewöhnen – Stichwort emotionale Trigger. Hat sich unser Gehirn einmal eingeprägt, auf eine bestimmte Situation beziehungsweise auf ein Situationsmuster mit Angst zu reagieren, wird diese Prägung nicht einfach so wieder verschwinden. Stattdessen wird sie mit jedem Mal stärker, bei dem eine erneute ähnliche Situation unsere Angst triggert.
Manchmal sind solche Trigger an Erfahrungen gebunden, die unsere Angst erklären. Hat mich zum Beispiel einmal ein Rauhaardackel in die Wade gebissen, mag das dazu führen, dass anschließend jeder Rauhaardackel in mir Angst auslöst, und wenn er noch so süß und friedlich ist. Hat mich einmal ein mir nahestehender Mensch betrogen, kann ich in jeder neuen engeren Beziehung Angst entwickeln zu vertrauen. Es müssen aber nicht immer (eigene) Erfahrungen zugrunde liegen, schließlich können Ängste ebenso gut auf Vorstellungen beruhen. Ich brauche mir nur vorzustellen, wie ich als alte Frau alleine in einem kleinen, dunklen Raum liege, um Angst vor Altersarmut und -einsamkeit zu bekommen. Denke ich nun jeden Abend, wenn ich allein im Bett liege, über diese Vorstellung nach, kann für mich das abends allein im Bett Liegen zu einer Triggersituation meiner Angst werden.
Bei unseren emotionalen Triggern ist es grundsätzlich sehr von Vorteil, wenn wir lernen, sie zu erkennen und zu verstehen, denn nur so können wir unsere Gefühle richtig einordnen und angemessen auf neue Erfahrungen reagieren.
Unbewusste Verstärkung durch Vermeiden
Falls wir uns im Umgang mit unserer Angst ungünstig verhalten, können wir sie damit dummerweise erheblich befeuern. "Wenn eine Person zum Beispiel Angst davor hat, mit der U-Bahn zu fahren und sich überwindet, in die U-Bahn zu steigen, um die Angst zu bezwingen, dann aber nach drei Stationen auf dem Höhepunkt ihrer Angst wieder aussteigt, weil sie es nicht mehr aushält, wird die Angst letztlich bestätigt und verstärkt", erklärt der Professor. "Nach sechs oder sieben Stationen wäre vielleicht Beruhigung eingekehrt, doch diese Erfahrung konnte die Person in so einem Fall eben nicht machen." An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine Konfrontationstherapie auf eigene Faust gehörig nach hinten losgehen kann. Grundsätzlich verstärken wir unsere Ängste aber, wenn wir Situationen vermeiden, die sie auslösen. Die Angst vor dem Scheitern ist da ein Klassiker: Oft stellen wir fest, dass es gar nicht schlimm ist, gescheitert zu sein, dass wir im Gegenteil sogar froh sind, etwas gewagt zu haben. Nicht immer, leider, aber oft.
Verdrängung anderer Emotionen
In einigen Fällen kann unsere Angst eine Art Stellvertreteremotion sein. Zum Beispiel für Erschöpfung und Überforderung. Oder für Wut und Hoffnungslosigkeit. So können wir beispielsweise in stressigen Phasen, in denen wir unter großem Druck stehen, statt Erschöpfung eine große Angst spüren und den Drang entwickeln, alles Mögliche zu kontrollieren und zu planen, was normalerweise von selbst läuft oder sich nicht kontrollieren lässt. Oder in einer Situation, in der wir eigentlich wütend auf die Welt oder andere Menschen sind, empfinden wir stattdessen Angst, selbst etwas falsch gemacht zu haben oder nichts ausrichten zu können – weil wir die Angst, nichts ausrichten zu können, vielleicht besser ertragen als die Gewissheit, es nicht zu können. Angst bietet sich als Stellvertreteremotion besonders an, da sie meistens ohnehin mitmischt, wenn uns unbekannte oder heftige Gefühle überwältigen – denn das ist nun einmal furchteinflößend.
In der Regel löst es unsere Probleme oder unsere Ängste noch nicht, wenn wir sie verstehen und erklären können. Manchmal ist es aber ein Ansatzpunkt und meistens gehört es zu dem Bewältigungsprozess dazu.
Prof. Dr. med. Andreas Ströhle ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist Leitender Oberarzt, Leiter des Fachbereichs Affektive Störungen und der Arbeitsgemeinschaft und Spezialambulanz für Angsterkrankungen an der Charité Berlin. Zusammen mit seinem Kollegen PD Dr. Jens Plag hat er das Buch "Keine Panik vor der Angst" (Randomhouse) veröffentlicht, das die Hintergründe von Panik und Angst erklärt und Strategien zur Bewältigung aufzeigt. Für die Gesundheitsplattform doctist hat Prof. Ströhle zusammen mit seinem Kollegen den Videokurs "Panik verstehen und besiegen" entwickelt. In sechs Modulen lernst du alles Wichtige über Angst und Panikattacken und erhältst hilfreiche Tipps und Strategien für den Weg zurück in ein angstfreies Leben.