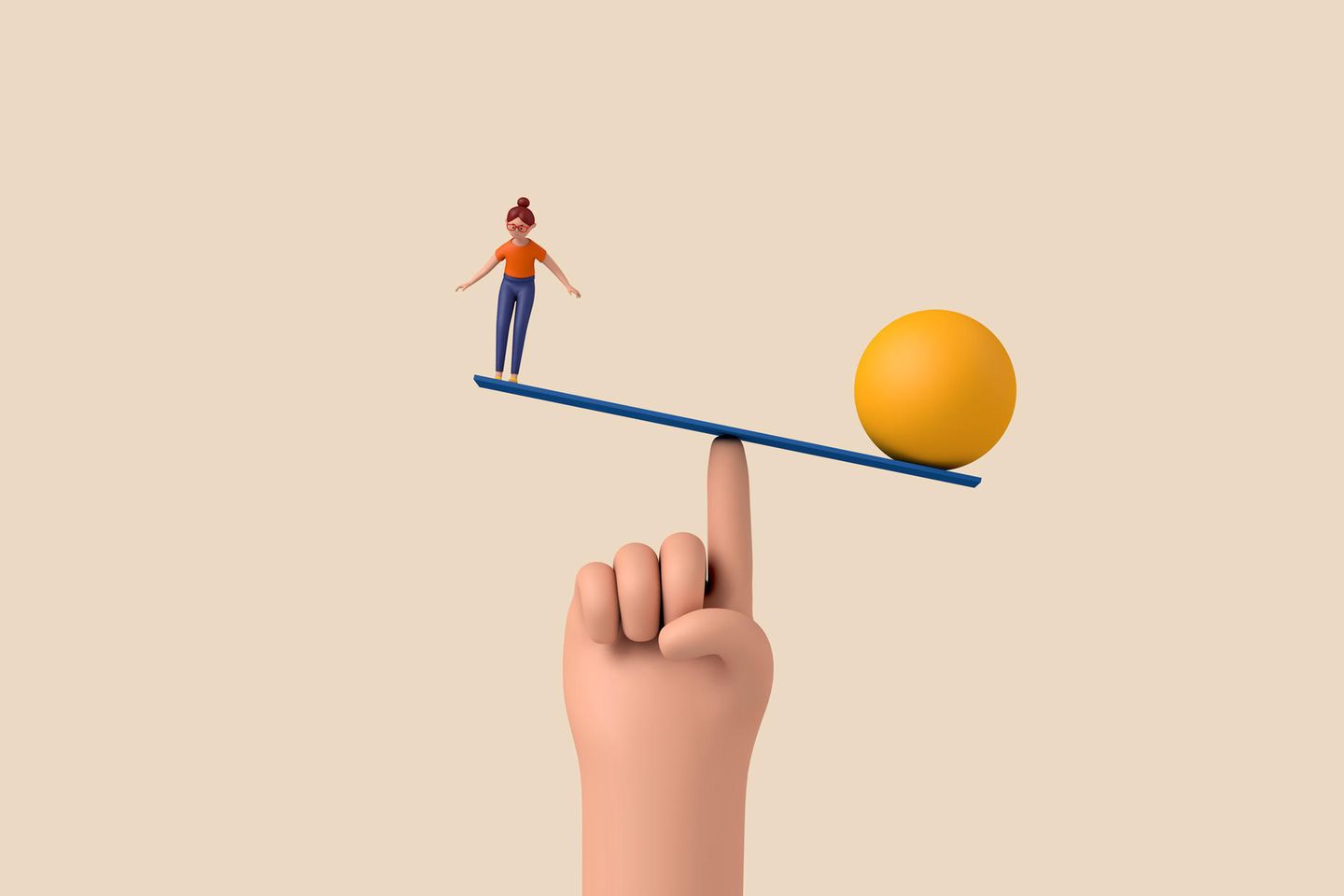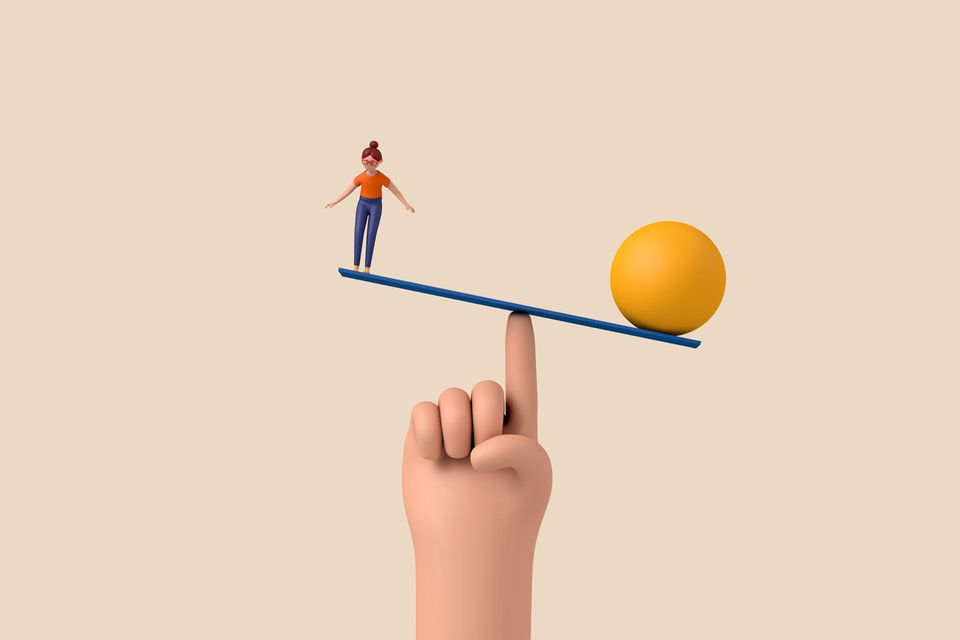Inhaltsverzeichnis
Stell' dir ein klassisches Konzert vor: Spielt nur ein Teil des Orchesters plötzlich mit einem verstimmten Instrument ein paar Töne tiefer oder höher, klingt die eigentlich harmonische Melodie unangenehm schräg. Auch im menschlichen Körper laufen ständig unzählige Prozesse ab, deren Gelingen vom perfekt aufeinander abgestimmten Teamwork des Orchesters – also der beteiligten Botenstoffe – abhängen. Ist der Hormonhaushalt gestört, wird es daher nicht unbemerkt bleiben: In diesem Fall geht es um die Symptome bei Östrogendominanz.
Was ist eine Östrogendominanz?
In der Medizin spricht man von einer Östrogendominanz, wenn der Östrogenspiegel im Blut im Verhältnis zum Progesteronspiegel zu hoch ist. Beide Sexualhormone steuern und beeinflussen den weiblichen Zyklus, die Fruchtbarkeit, Pubertät und Wechseljahre.
In der ersten Zyklushälfte steht das Fruchtbarkeitshormon Östrogen im Vordergrund, es baut zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut auf, fördert Zellwachstum und -entwicklung. Sein Gegenspieler, das Progesteron, dominiert die zweite Zyklushälfte. Es wird auch Gelbkörperhormon genannt, weil es hauptsächlich vom Corpus luteum (Gelbkörper) gebildet wird. Progesteron, ein natürliches Gestagen, bereitet unter anderem die Schleimhaut für die Einnistung der Eizelle vor und hat schwangerschaftserhaltende Wirkung. Daher auch der Name Progesteron, der die lateinischen Worte „pro“ (für) und „gestare“ (tragen) vereint.
Bei einer Östrogendominanz gerät dieses Zusammenspiel zwischen Östrogen und Progesteron aus der Balance. Entweder, weil der Östrogenspiegel zu hoch oder aber der Progesteronspiegel zu niedrig ist. Begrifflich sind daher zwei Arten zu unterscheiden:
- Absolute Östrogendominanz:
Der Progesteronwert liegt im Normalbereich, es befindet sich aber insgesamt zu viel Östrogen im Blut (der Absolut-Wert des Östrogens ist zu hoch). - Relative Östrogendominanz:
Der Östrogenpegel hat den Sollwert oder liegt sogar darunter, die Progesteronkonzentration ist dafür jedoch zu niedrig (der Östrogenwert ist relativ zu hoch für den geringen Progesterongehalt).
Typische Symptome bei Östrogendominanz
Eine der häufigsten Hormonstörungen bei Frauen ist die Östrogendominanz. Sie kann sich durch verschiedene Beschwerden äußern, dazu gehören:
Zyklusstörungen
Probleme mit dem Menstruationszyklus zählen zu den stärksten Symptomen bei Östrogendominanz. Typisch ist es zum Beispiel, wenn die Regelblutung unregelmäßig wird, wenn sie schwächer ausfällt als sonst, oder es zu sehr starken oder langen Blutungen kommt. Auch Zwischenblutungen beziehungsweise Schmierblutungen können auftreten.
PMS (Prämenstruelles Syndrom)
Häufig wird beobachtet, dass sich im Zuge einer Östrogendominanz ein bis zwei Wochen vor der Periode PMS-Beschwerden verschlimmern können. Frauen, die anfällig dafür sind, berichten über stärkere Stimmungsschwankungen oder Reizbarkeit, über vermehrte Kopfschmerzen, Blähungen oder Spannungsgefühl in den Brüsten.
Gewichtszunahme
Fetteinlagerungen, insbesondere die als typisch weiblich geltende Birnenform, also die Fettansammlung an Bauch, Hüfte, Taille, Po und Oberschenkeln, gehen zum Teil auf das Konto des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. Frauen mit Östrogendominanz nehmen daher eher zu und werden diese Fettpölsterchen auch schlechter wieder los. Auch in den Wechseljahren ist das der Fall (lies hierzu auch unsere Artikel Gewichtszunahme in den Wechseljahren oder Wechseljahre und Bauchfett).
Wassereinlagerungen
Manchmal sind es keine „echten“ Speckschichten, sondern lediglich Wassereinlagerungen (Ödeme), die uns dicker und aufgedunsen fühlen lassen. Das liegt daran, dass Östrogen Einfluss auf den Flüssigkeitshaushalt des Körpers nimmt, was zu Wassereinlagerungen im Gewebe führen kann. Das typische Brustspannen kann von diesen Flüssigkeitseinlagerungen ausgelöst werden.
Gutartige Gewebeveränderungen
Kursiert zu viel Östrogen im Organismus, steigt das Risiko für fibrozystische Veränderungen. Verständlicher ausgedrückt: Es können flüssigkeitsgefüllte Hohlräume (Zysten) entstehen, zum Beispiel in den Brüsten, die du als kleine Knötchen ertasten kannst. Auch an den Eierstöcken können sich diese Zysten bilden. Oder es wachsen Myome an und in der Gebärmutter. Myome sind gutartige Tumore, die aus Muskel- und Bindegewebsfasern bestehen. Ihr Wachstum wird durch Östrogene gefördert.
Fehlende Energie
Chronische Müdigkeit und allgemeine Erschöpfung, obwohl du ausreichend schläfst, treten häufig im Zusammenhang mit einer Östrogendominanz auf.
Verringerte Libido
Keine Lust auf Sex, das kann hormonelle Gründe haben. Vor allem ein zu hoher Östrogenspiegel mit seinen Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden macht sich manchmal auf diese Art bemerkbar.
Geringere geistige Leistungsfähigkeit
Vielleicht hast du das Buzzword Brain-Fog schon mal gehört. Zu viel Östrogen kann zu dazu führen, dass du dich nur schlecht konzentrieren kannst, dass dein Gedächtnis dich manchmal im Stich lässt, dir Worte nicht einfallen wollen oder du ständig etwas vergisst – als stünde dein Hirn mitten im Nebel. Denn der Botenstoff Östrogen ist auch an der Produktion von Neurotransmittern beteiligt, über die unsere Nervenzellen kommunizieren. Zu viel kann da genauso stören wie zu wenig.
Seelische Probleme
Bei manchen Frauen mit Östrogendominanz entstehen ungewohnte Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit, auch Ängste und depressive Episoden können auftreten. Das liegt daran, dass Östrogen auf Neurotransmitter wie etwa Serotonin wirkt, das umgangssprachlich auch als Glückshormon gilt.
Weitere mögliche Beschwerden, die im Zusammenhang mit einer relativen oder absoluten Östrogendominanz auftreten können:
- Haarausfall
- Schlafstörungen
- Blähungen
- Kopfschmerzen, Migräne
Wie wird sie diagnostiziert?
Den Verdacht auf eine Östrogendominanz kann nur eine Laboruntersuchung bestätigen. Am häufigsten kommen dabei Bluttests zum Einsatz, um den Östrogenspiegel im Verhältnis zum Progesteronspiegel zu ermitteln. Da der Progesteronwert im Verlauf des Zyklus laufend schwankt, wird er üblicherweise in der Lutealphase gemessen, also rund eine Woche vor der erwarteten nächsten Regelblutung. Hormonspezialist:innen ziehen häufig auch noch weitere Blutwerte in die Analyse mit ein, wie etwa Schilddrüsenhormone, FSH (follikelstimulierendes Hormon, LH (luteinisierendes Hormon).
Eine andere Methode, den Hormonspiegel zu ermitteln, ist der Hormonspeicheltest. Nur im Speichel können freie, das heißt nicht an Proteine gebundene Hormone gemessen werden, was ein genaueres Bild ergibt. Denn nur diese freien Hormone sind im Körper biologisch aktiv. Doch die Hormonkonzentration kann im Speichel stark schwanken und es müsste durch mehrere Proben ein zuverlässiger Mittelwert gebildet werden. Deshalb raten Fachleute von frei erhältlichen Speichel-Selbsttests ab.
Was verursacht eine Östrogendominanz?
Wenn im Verhältnis zum Progesteron übermäßig viel Östrogen vorhanden ist, liegt das entweder daran, dass zu viel Östrogen (absoluter Östrogenüberschuss) oder zu wenig Progesteron gebildet wird (relativer Östrogenüberschuss, Progesteronmangel).
Die 7 Hauptgründe für die Entstehung einer Östrogendominanz:
- Wechseljahre
Zu Beginn der Wechseljahre, in der Prämenopause und der frühen Perimenopause, sinkt zunächst der Progesteronspiegel ab. Die Funktion der Eierstöcke wird schwächer und nicht mehr in jedem Zyklus reift ein Ei heran. Das möchte der Organismus nicht wahrhaben und schiebt die Östrogenproduktion noch einmal kräftig an, um die Eierstöcke dazu zu bringen, wieder einen Eisprung zu ermöglichen. In dieser Zeit herrscht also natürlicherweise kurzzeitig ein relativer Östrogenüberschuss. Nach der Menopause fällt dann auch der Östrogenspiegel ab und beendet das Hormonchaos und die Östrogendominanz wieder. - Übergewicht
Fettgewebe, insbesondere das Bauchfett, produziert Östrogen. Es gilt daher als eigenes Organ. Bei einem hohen Körperfettanteil ist daher meist auch der Östrogenspiegel erhöht. - Stress
Der Körper schüttet bei Stress das Hormon Cortisol aus und fährt dafür die Progesteronproduktion zurück. Je länger die Stressphase anhält und für einen hohen Cortisolspiegel sorgt, desto eher ergibt sich eine relative Östrogendominanz – weil es an Progesteron mangelt. - Aufnahme von Fremdöstrogenen (Xenoöstrogene)
Xenoöstrogene oder auch endokrine Disruptoren sind chemisch-synthetische Stoffe mit östrogenähnlicher Wirkung im Körper. Sie stecken zum Beispiel als Weichmacher in Kunststoffen oder Konservierungsmittel in Körperpflegeprodukten. - Gestörte Leberfunktion
Die Leber ist unsere Entgiftungszentrale. Arbeitet das Organ nicht richtig, werden überschüssige Stoffe nicht ausgeschieden, sondern können sich ansammeln – so auch Östrogen. Starker Alkoholkonsum und bestimmte Medikamente belasten die Leber, was schlimmstenfalls ihre Funktion beeinträchtigt. - Unausgewogene Hormontherapie
Frauen, die unter starken Wechseljahresbeschwerden leiden, können mit einer Hormonersatztherapie behandelt werden. Dabei muss nicht nur der Östrogenwert in den Blick genommen werden, sondern auch der Progesteronspiegel, um den Hormonstoffwechsel in der Balance zu halten. - Bestimmte Erkrankungen
Eine Östrogendominanz kann auch im Zusammenhang mit PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom), Insulinresistenz, Endometriose und – in seltenen Fällen – bei Nebennierentumoren entstehen.
Ist ein zu hoher Östrogenspiegel gefährlich?
Im Verlauf der Wechseljahre ist eine Phase der Östrogendominanz ganz normal und kein Grund zur Besorgnis. Denn in der Frühphase der Perimenopause sinkt zunächst nur der Progesteronspiegel ab, der Östrogenspiegel bleibt aber noch konstant hoch, bis er nach der Menopause, der letzten Menstruationsblutung, stark abfällt. In diesem Fall ist die Östrogendominanz eine natürliche, von allein wieder endende Phase.
Ein dauerhafter Überschuss an Östrogen dagegen kann durchaus gesundheitliche Folgen haben und zum Beispiel Asthma verschlimmern. Außerdem wird ein erhöhtes Erkrankungsrisiko angenommen für:
- Bluthochdruck
- Thrombosen (Gefäßverschluss durch Blutklumpen)
- Gebärmutterhalskrebs
- Brustkrebs
- Schilddrüsenkrebs
Mit welchen Maßnahmen lässt sich gegensteuern?
Entscheidend ist, welche Ursache hinter dem hormonellen Ungleichgewicht steckt und wie stark die Beschwerden ausfallen. Neben einer medikamentösen Behandlung durch eine Ärztin oder deinen Arzt, etwa einer kurzzeitigen Hormonersatztherapie während der Wechseljahre, kannst du mit bestimmten Lebensstilveränderungen Einfluss auf die Hormonbalance nehmen:
- Aktiver Stressabbau, zum Beispiel durch regelmäßige Bewegung, Meditation lernen, Autogenes Training, Tai Chi oder ähnliches.
- Vermeidung von hormonwirksamen Umweltgiften, zum Beispiel in Kosmetika (achte in der Zutatenliste darauf, ob die schädlichen Phthalate enthalten sind) oder Lebensmittelverpackungen aus Plastik, aber auch Konsumgifte, wie Alkohol oder Nikotin, um das Entgiftungsorgan Leber zu schonen.
- Vollwertige, selbst gekochte Ernährung mit reichlich Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, gerne in Bio-Qualität, weil herkömmliche Landwirtschaft Pestizide einsetzt. Schraube den Genuss von verarbeiteten Lebensmitteln möglichst stark herunter.
Können auch Männer betroffen sein?
Ja, das ist möglich. Ebenso wie Frauen ein gewisses Level am männlichen Geschlechtshormon Testosteron haben, kommt das weibliche Sexualhormon Östrogen auch bei Männern vor. Bei ihnen kann ein gestörter Östrogenstoffwechsel ein verstärktes Brustwachstum, Unfruchtbarkeit, erektile Dysfunktion und Depression verursachen.
Quellen:
- Frauenärzte im Netz: Hormonumstellung in den Wechseljahren, Stand 18.05.2018
- Medical News Today: What are the symptoms of high estrogen?, Stand 17. 01.2024
- NetDoktor: Östrogendominanz, 15.07.2023