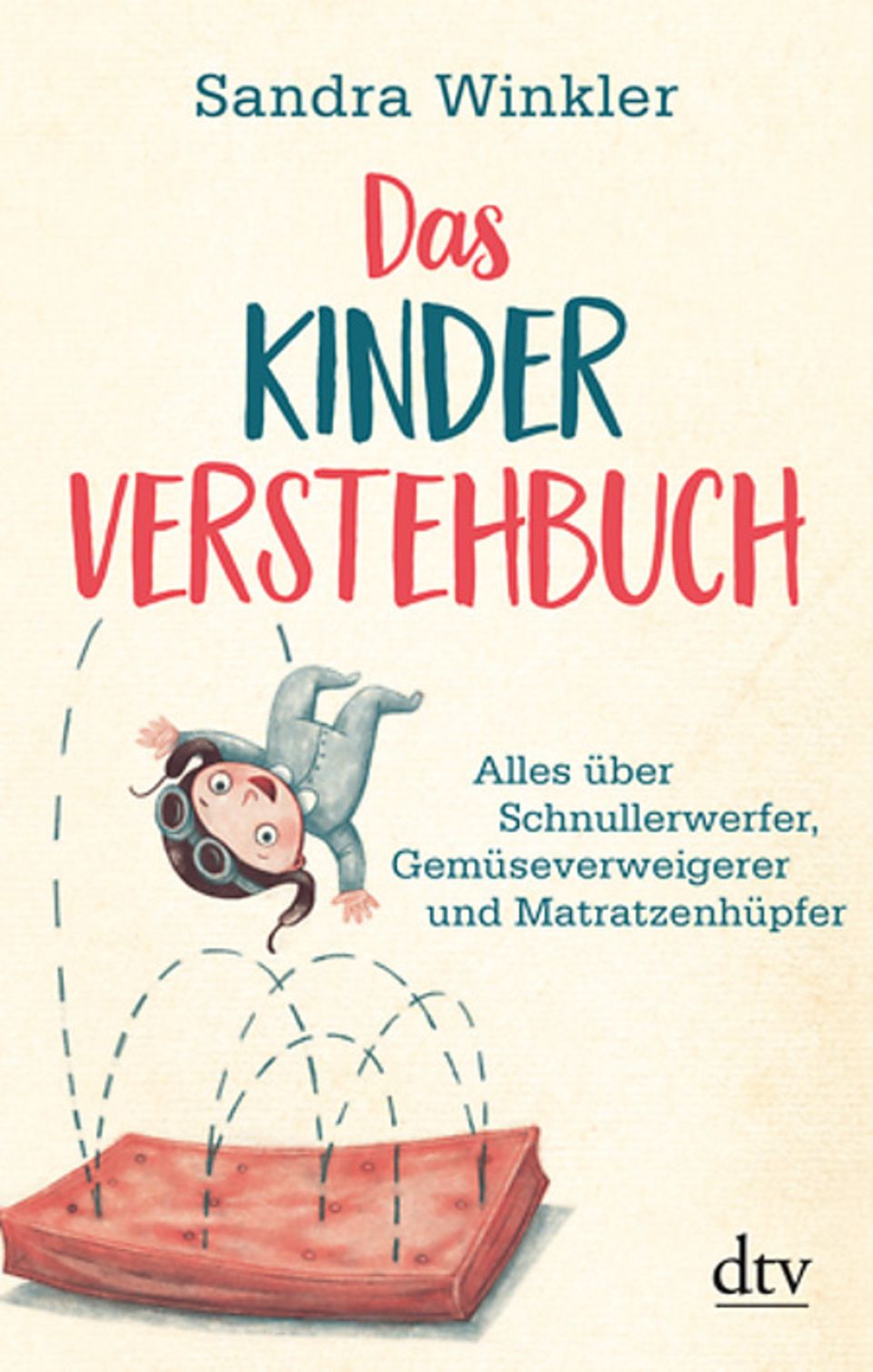Kinder müssen herausfinden, wie sich Dinge verhalten
Schon seltsam, was manche Eltern ihren Babys so alles unterstellen. Internetforen lassen da tief blicken. In einem schreibt eine Mutter, ihr Sohn würde sie ärgern. Er schmeiße seit Wochen alles herunter: Rasseln, Löffel, Schnuller, Kartoffelbrei. Einfach alles. Sie schimpfe deshalb mit dem Kleinen und habe ihm schon hundert Mal gesagt: "Nein!" Doch keine Besserung. Sie sei verzweifelt und inzwischen so sauer, dass sie dem Kind auf die Finger haue. "Warum provoziert er uns nur so?", fragt die Mutter verzweifelt in die virtuelle Runde.
Dort kennen alle dieses Problem. Eine "scheußliche Phase", heißt es dort mitfühlend. Jemand schlägt vor, das Kind für ein paar Minuten in ein anderes Zimmer zu stecken, wenn mal wieder etwas zu Boden rauscht. Ein anderer meint, es würde helfen, dem werfenden Kleinen einfach keine Beachtung mehr zu schenken. Harte Maßnahmen – vor allem, wenn man weiß, dass hier gar keine Rebellion stattfindet, sondern Forschungsarbeit. Einen Gegenstand zu werfen oder ihn fallen zu lassen, bedeutet für ein Kind, das zwischen sechs und 18 Monaten alt ist, die Welt zu erkunden. Wie ein Alien, der gerade auf der Erde gelandet ist, muss es herausfinden, wie sich die Dinge um es herum verhalten.
Experimente für Mini-Newton und Baby-Curie
Wenn wir Erwachsenen zum Beispiel ein Stück Karotte in die Hand nehmen und loslassen, wissen wir ganz genau, wie und wo das enden wird: Zunächst einmal fällt das Gemüse nach unten, trifft circa eine halbe Sekunde später mit einem leisen Tock-Geräusch auf dem Boden auf, springt dort zwei, drei Mal hoch und bleibt dann regungslos, aber gut erhalten liegen. Wir wissen auch, dass die Karotte weiter fliegt, wenn wir sie werfen, und dass das "Tock" des Aufpralls dann etwas später erfolgt. Wir kennen die Flugeigenschaften unserer Karotten – und fast aller anderen Gegenstände ebenfalls. Für uns ist die Welt vorhersehbar geworden – zumindest in Bezug auf ihre physikalischen Gesetze. Für ein Baby ist es aber eine hochinteressante Erkenntnis, dass ein Karottenstück nicht schwebt oder aufsteigt, wenn man es loslässt – und dass es beim Herunterfallen nicht matschig am Boden klebt, scheppernd zerbricht oder rasant durch die Küche rollt. Deshalb thront es in seinem Kinderstuhl und schubst immer und immer wieder die Milchflasche über den Tischrand oder wirft eine Rassel im hohen Bogen aus der Karre. Mal feuert es ein Ding aus der Faust ab, mal lässt es ein Testobjekt aus dem Zweifingergriff fallen oder kippt es sanft aus der Handfläche.
Was dann passiert, muss immer wieder aufs Neue überprüft werden. Wer weiß, vielleicht ist das, was man gestern gesehen hat, inzwischen gar nicht mehr aktuell. Ob die Erdanziehung wohl auch heute noch funktioniert? Wenn Mini-Newton und Baby-Curie ihre Experimente durchführen, nutzen sie dabei tatsächlich so etwas wie wissenschaftliche Methoden. Sie können statistische Regelmäßigkeiten und Abweichungen erkennen und entwickeln ein besonderes Interesse, sobald es um neue Informationen geht. Ein Team an der Universität im amerikanischen Rochester spielte acht Monate alten Babys lange Reihen von Silben vor. In einer Variante folgte zum Beispiel "da" grundsätzlich auf "bi", "bi" jedes dritte Mal auf "ro". Dann ließ man neue Silbenfolgen ablaufen. Entsprachen diese den Mustern, waren die Babys nicht weiter interessiert. Durchbrachen sie sie, hörten die Kleinen länger und aufmerksamer zu.
Naturwissenschaftliches Verständnis bereits bei Babys
Früher dachte man, Babys seien in den ersten Monaten schlichtweg dumm. Unfertige Erwachsene eben. Die neuere Säuglingsforschung geht davon aus, dass mehr logisches Denken in den kleinen Köpfen steckt als vermutet und dass Babys bereits in den ersten Monaten ein naturwissenschaftliches Verständnis haben. Forschungsteams beobachteten, dass Babys länger auf Autos starrten, die wider Erwarten (durch einen Trick) durch Wände fahren konnten. Oder die Kleinen wunderten sich, wenn ein Ball, der präpariert wurde, aus einer geöffneten Hand nicht zu Boden fiel. Eine gewisse Vorstellung davon, was Statistik, Schwerkraft, Bewegungsbahnen sind, müssen sie demnach haben, sogar schon bevor sie selbst mit gezielten Experimenten beginnen.
Unterschätzen Sie also nie ein Baby. Kinder sind Experten darin, sich Wissen anzueignen. Und auch wenn es nervig ist, dass der Schnuller, den man gerade erst vom Boden aufgesammelt hat, weil der Nachwuchs ihn ganz furchtbar dringend wiederhaben musste, jetzt schon wieder an einem vorbeifliegt – für den Wissensdurst seines Kindes lohnt es sich, den Rücken krumm zu machen oder auf Knien herumzurutschen. Später, wenn die Kinder in der Schule Physik und Chemie abwählen, sobald es möglich ist, wären wir doch froh über so viel unbändigen Forschungsdrang. Also los! Nicht dem Kind entnervt das Wegwerfmaterial aus den Händchen reißen, sondern am besten immer wieder neues anreichen. Vielleicht nicht das Meißner Porzellan. Aber auch mal Erbsenpüree.
Neben Natur- und Materialforschung erfolgt Sozialforschung …
Eltern sind als wissenschaftliche Assistenten gefragt. Und das nicht nur, um die Gegenstände zu apportieren, an die das Baby allein nicht herankommt. Die elementare Natur- und Materialforschung ist zugleich empirische Sozialforschung. Heben Eltern immer und immer wieder auf, was der Nachwuchs fallen lässt, dann kann er sich zum einen sicher sein: Auf sie ist Verlass. Zum anderen studieren die Kleinen, nachdem sie etwas fallen gelassen haben, die Reaktionen der großen Menschen. Lasse ich ein Tuch zu Boden segeln, schaut keiner. Lasse ich aber im Restaurant den Teller vom Tisch stürzen, sind alle Blicke sofort auf mich gerichtet. Interessant! Und – da Kinder Aufmerksamkeit lieben – toll. Man kann es mal mit einem Nein versuchen, aber besser räumt man alles außer Reichweite und bringt vielleicht ein paar unkaputtbare Gegenstände von zu Hause mit.
Sich über lautes Geschepper und ausgekippte Trinkbecher aufzuregen, ist allerdings sinnlos. Das Baby sieht bloß: "Aha, Mama wird laut und bekommt eine dicke Ader auf der Stirn, wenn ich mit meinem Käsetoast werfe." Dass das Ärger ist, weiß es noch nicht. Erst mit ungefähr drei Jahren wird es in der Lage sein, sich in jemanden hineinzuversetzen und dessen Gefühle und Absichten zu verstehen. Wahrscheinlich wirft es vorher erst recht noch einmal den Käsetoast – denn es muss ja prüfen, ob Mama jedes Mal laut wird, wenn es das macht.
Warum essen Kinder immer das Gleiche? Warum haben Kinder Angst vor Monstern unter ihrem Bett und warum steckt in kleinen Kindern so viel Wut? Bei frisch gebackenen Eltern tauchen plötzlich ganz viele Fragen auf! Sandra Winkler gibt in "Das Kinderverstehbuch. Alles über Schnullerwerfer, Gemüseverweigerer und Matratzenhüpfer" Antworten darauf und klärt über die gängigsten Verhaltensweisen von Babys und Kleinkindern auf. Mit Erkenntnissen aus der Psychologie, Entwicklungspädiatrie und Neurologie lässt sie uns unsere kleinen Mitmenschen besser verstehen – und das auf humorvolle Weise.
Dein Baby hat Probleme beim Einschlafen? Hier erfährst du mögliche Gründe zum Thema "Baby schläft nicht".
Copyright: Sandra Winkler "Das Kinderverstehbuch. Alles über Schnullerwerfer, Gemüseverweigerer und Matratzenhüpfer" , 2020, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München