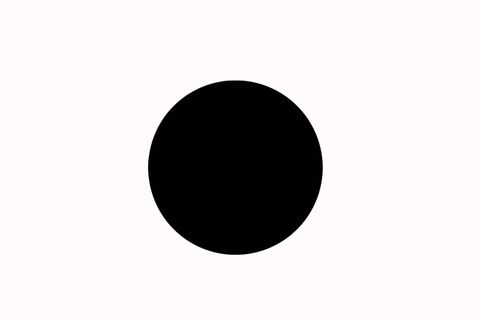Meine Kollegin am Schreibtisch gegenüber legte den Hörer auf, lehnte sich zurück, seufzte zufrieden und sagte dann, mit einem verträumten Blick aus dem Fenster: "Das habe ich richtig gut gemacht."
Ich war ein wenig erstaunt. Wir arbeiteten zusammen an einem Projekt, von dem jeder wusste, dass es zum Scheitern verurteilt war. Weshalb wir nur Ärger hatten und nie ein gutes Wort zu hören bekamen. Gerade, so viel wusste ich, war es meiner Kollegin immerhin gelungen, eine unangenehme Aufgabe an eine andere Abteilung abzuwälzen. Wir hatten also ausnahmsweise mal Schwein gehabt.
"Alles in Ordnung?", fragte ich.
"Ja", sagte sie, "ich hab das super geregelt eben."
"Kann es sein, dass es hier komisch riecht?", fragte ich, weil ich, wenn ich nicht gut drauf bin, Sprüche aus meiner Grundschulzeit reaktiviere.
"Das ist mein Kräutertee", sagte die Kollegin.
"Nee", vollendete ich meinen Grundschulspruch, "Eigenlob stinkt."
"Im Gegenteil", sagte meine Kollegin. "Ich lobe mich jetzt nur noch selbst. Wenn’s sonst schon keiner tut." Und dann holte sie sich außerplanmäßig einen Schokoriegel am Automaten, um ihren Erfolg zu feiern. Okay, es war nur ein Schokoriegel, aber es war ihre erste Einfach-so-Pause seit ewig. Darum war dies der Moment, in dem ich ahnte: Eigenlob stinkt nicht, sondern es duftet nach Freiheit und Abenteuer.
Warum wir endlich anfangen müssen, uns selbst zu feiern
Wir sind es nicht gewohnt, uns selbst zu feiern. Wir kritisieren uns lieber und lechzen nach Anerkennung von außen. Dabei hat Eigenlob schon bei banalsten Alltagstätigkeiten eine Strahlkraft, von deren Glanz sogar andere noch was haben. Die Nachbarin kommt früh vom Einkaufen zurück und freut sich, dass sie das am Samstagmorgen so gut hinter sich gebracht hat: "Den Großeinkauf habe ich heute gerockt, du hättest mich sehen sollen, ich war ein Star." Wir reden wie gesagt nur über Einkäufe, aber ihr Eigenlob ist mitreißend, es heitert mich auf und lädt mich ein, mich selbst positiver zu sehen.
Wir sind es nicht gewohnt, uns selbst zu feiern.
Eine Freundin hat gekocht und sagt, als wir gerade anfangen zu kauen: "Gebt es zu, das ist das Leckerste, was ihr je gegessen habt." Na ja, fast, aber: Egal, denn ihr Eigenlob verbreitet sofort Heiterkeit und lädt ein zur Anerkennung – stimmt, das schmeckt wirklich sehr gut. Wenn Eigenlob schon im Kleinen funktioniert, dann hat es das Potenzial, unser ganzes Leben zu verbessern. Und darum müssen wir endlich anfangen, uns selbst zu feiern.
Zum einen Teil ist das eine gesellschaftliche Forderung, zum anderen Teil psychologische Notwendigkeit. Gesellschaftlich, weil, wenn der Druck immer größer wird und die Arbeit immer mehr und die Anforderungen an die Rollen, die wir spielen müssen, immer höher: Wer soll uns dann in all dem neoliberalen Gewusel noch loben, wenn nicht wir uns selbst? Und psychologisch, weil nur Eigenlob uns innerlich stark und emotional unabhängig machen kann.
Ist doch egal, was die anderen sagen
Der Autor Heinz-Peter Röhr war lange psychotherapeutisch tätig. 2013 hat er ein hellsichtiges und grundsätzliches Buch über "Die Kunst, sich wertzuschätzen" veröffentlicht. Ein faszinierender Aspekt darin ist, dass Röhr die Anerkennung durch sich selbst viel höher einschätzt als das Lob anderer. "Selbst, wenn wir Anerkennung von außen bekommen, wird sie uns nie genügen", sagt Röhr im Gespräch mit BRIGITTE WOMAN. "Anerkennung von anderen ist wie eine Droge: Man braucht eine immer höhere Dosis, es ist nie der Punkt erreicht, an dem es gut ist. Echte Anerkennung, die es einem erlaubt, diese Teufelskreise zu verlassen, kann nur von innen kommen. Anerkennung, die von außen kommt, macht einen zum Sklaven der Erwartungen und Anforderungen anderer."
Tatsächlich unterscheidet die Psychologie zwischen zwei verschiedenen Arten, wie wir unseren Wert empfinden: Das eine ist das explizite, das andere das implizite Selbstbewusstsein. Anerkennung von außen nützt dem expliziten Selbstbewusstein, darauf beruht zum Beispiel das Geschäftsmodell von Facebook: Ich zeige euch meine wohlgeratenen Kinder, meinen blühenden Garten, meine selbst gekochten Marmeladen und hoffe, ihr klickt "gefällt mir". Viel wichtiger aber für die Lebenszufriedenheit ist das implizite Selbstbewusstsein, das Gefühl, das wir als eine Art Grundlagenvertrag zwischen uns und dem Rest der Welt in uns tragen: die Fähigkeit, tief zu empfinden, dass wir dies oder jenes wirklich gut gemacht haben.
Warum Eigenlob Beschlusssache ist
Jahrelang habe ich gedacht, einer meiner ältesten Freunde hätte einfach einen Tick, denn jedes Mal, wenn etwas für ihn gut läuft, pflegt er wie zu sich selbst zu sagen: "Alles richtig gemacht." Wenn im Restaurant das Essen schmeckt, wenn der Ausflugssee schön ist, ja, verdammt, wenn ihm einfach nur die Spätsommersonne aufs Haupt scheint: "Alles richtig gemacht."
Für mich sind solche Erlebnisse Glücksmomente im Sinne von "Glück gehabt", aber es scheint mir ein schicksalhaftes Glück. Doch es gibt Menschen wie meinen Freund, die ein Talent fürs großzügige Eigenlob haben: Er hat sich das Essen ja bestellt, ist rausgefahren, ist in die Sonne gegangen. Warum also das nicht mal mit ansteckender Selbstzufriedenheit festhalten? Alles richtig gemacht.
Für alle, die dieses Talent nicht haben, ist Eigenlob Beschlusssache. Fangen wir ganz unten an: die Bude gesaugt, das Bad gewischt. Endlich fertig? Nein: gut gemacht. Um uns dann langsam höherzuarbeiten: das Problemgespräch mit der Chefin, die Steuererklärung, endlich doch den aufgeschobenen Zahnreinigungstermin wahrgenommen. Puh, gut, dass das durchgestanden ist? Nein, super hingekriegt!
Es gibt Menschen, die ein Talent fürs großzügige Eigenlob haben.
Ganz ehrlich, egal, wie’s inhaltlich gelaufen ist: Allein die Kraft zum Abhaken aufzubringen war eine erstklassige Leistung. Die wer vollbracht hat? Ich. Na also. Oder, ganz grundsätzlich und höchstes Niveau zugleich: Nachts aufwachen, und neben einem liegt wie schon seit Jahren jemand und atmet vor sich hin. Irgendwie ganz gemütlich? Nee, im Ernst: Was für ein Riesending, einen Menschen zu finden, mit dem man es dann doch so lange Zeit aushält, und oft ist es sogar schön, hey, keine Ahnung, wie ich das wieder hingekriegt habe, aber im Prinzip eine Aufgabe, an der man eigentlich nur scheitern kann. Bin ich aber nicht: Wahnsinn, richtig gut gemacht.
Übrigens eignen sich auch die Kinder gut zum Üben, wenn man welche da hat. Egal, wie alt sie gerade sind. Man hält sie einen Moment fest, mustert sie und sagt: "Gut gemacht." Sie wundern sich und fragen: "Was denn?" Und dann sagt man: "Na, dich. Dich hab ich gut gemacht." Die Kinder denken, man spinnt, aber das denken sie sowieso.
Wie der Zauber des Eigenlobs uns hilft, den Ballast der Vergangenheit abzuwerfen
Heinz-Peter Röhr sagt, dass unser Selbstwertgefühl dadurch bestimmt wird, ob und wofür wir in unserer Kindheit Wertschätzung erfahren haben oder nicht. Wenn nicht, bleibt ein lebenslanges unbewusstes Grundgefühl, etwa "Ich bin nicht willkommen". Oder "Ich genüge nicht". Oder "Ich bin zu kurz gekommen". Deshalb versuchen wir, unser Selbstwertgefühl auf immer die gleiche untaugliche Art zu reparieren. Wer etwa das lebenslange Gefühl "Ich genüge nicht" hat, stürzt sich in die Arbeit, um durch Erfolg Anerkennung zu bekommen. Die, wie wir wissen, in den meisten Fällen ausbleibt, wodurch das Gefühl, nicht zu genügen, wieder aufgeladen wird und der Leistungsdruck weiter steigt: klassischer Teufelskreis. Oder die vielen Menschen, die die quälende Kindheitsahnung in sich tragen, nicht willkommen zu sein. Deren Gegenprogramm ist eventuell, anderen zu helfen und sich für sie aufzuopfern, um endlich das Signal zu bekommen, richtig zu sein und gebraucht zu werden. Was nie ausreicht, um das ewige "Ich bin nicht willkommen" zu übertönen, also wieder: Teufelskreis.
Der Ausweg, den Röhr in seinem Buch beschreibt, wirkt wie eine grundsätzliche Eigenlob-Therapie: Man analysiert mithilfe einfacher Fragen zur Kindheit und Persönlichkeit, unter welchem Defizit das eigene Selbstwertgefühl leidet. Wer herausfindet, dass er sich nie willkommen gefühlt hat, installiert gewissermaßen ein neues Programm und lernt, sich selbst willkommen zu heißen. Bei dem Grundgefühl, nicht zu genügen, geht es darum, zu einer positiven Einschätzung der eigenen Person zu gelangen. Aus "Ich bin zu kurz gekommen" wird "In mir ist alles, was ich brauche". Röhr weiß, dass dies eine Lebensaufgabe ist: "Man wird nie ganz fertig damit. Aber es lohnt sich, um mit sich selbst und anderen besser zurechtzukommen."
Faszinierend daran ist der Grundgedanke: Die Erlaubnis, sich selbst zu loben, kann eine solche Kraft, einen solchen Zauber entfalten, stark genug, um die Schatten der Kindheitsprägung hinter sich zu lassen. Wer sich selbst lobt, kann sich demnach also geradezu befreien. Und was wäre ein schöneres Eigenlob, als zu sagen: "Ich genüge immer"?
Warum das Potenzial des Eigenlobs sich gerade in der Lebensmitte entfaltet
"Ich genüge immer": Das ist gerade jenseits der 40 eine Selbsterkenntnis und Selbsterlaubnis, die einem nicht besonders nahe liegt. Weil vielleicht die pubertierenden oder fast erwachsenen Kinder noch an unseren Nerven zerren und die Eltern hilfsbedürftig werden, das eigene Älterwerden auch gerade kein Zuckerschlecken ist – da fühlt man sich manchmal ganz schön unzulänglich. Aber genau deshalb ist es die beste Zeit, um damit anzufangen, sich selbst zu loben. Weil man’s braucht und weil man besser einschätzen kann, wenn man was gut gemacht hat; besser als eine Berufsanfängerin oder jemand, der erst am Anfang der Herausforderung steht, so was Anspruchsvolles wie eine längere Beziehung oder gar eine Ehe zu führen. Weil man schon was hat, worauf man zurückblicken kann.
Und ganz ehrlich: Einigermaßen über die Runden zu kommen, ohne durchzudrehen, ohne morgens einfach liegenzubleiben, abzuhauen oder sich ganz aufzugeben, ist schon eine Leistung, die aus ganz vielen Erfolgen besteht, für die wir uns selbst nie gelobt haben. Jedes Leben, das nicht darin mündet, dass sich jemand schreiend die Kleider vom Leib reißt und wie blind auf eine stark befahrene Staße rennt, ist eine unfassbare Erfolgsgeschichte. Wir müssen nur anfangen, sie zu erzählen. Zuerst mal uns selbst.
Eigenlob duftet auch deshalb nach Freiheit und Abenteuer, weil es uns mutiger macht.
Klar, die gesellschaftlich akzeptierte Erfolgsdefinition ist eine andere, aber genau das ist das subversive Potenzial des Eigenlobs: Wenn wir uns bewusst machen, was wir sowieso schon alles erreicht haben, können wir aus der ewigen Spirale ausbrechen, die unser System aus Überforderung, Erschöpfung, verbesserter Selbstoptimierung, mehr Leistung und wiederum Überforderung am Laufen hält.
Ausbrechen ist ein Schlüsselwort. Oft fehlt uns der Mut, wirklich etwas in unserem Leben zu ändern, Dinge hinter uns zu lassen und was Neues zu suchen, eben: der Mut, auszubrechen. Aber Eigenlob duftet auch deshalb nach Freiheit und Abenteuer, weil es uns mutiger macht. Wir sollten uns endlich loben für scheinbar kleine Verhaltensweisen, die uns fast selbstverständlich erscheinen. Weil sie in Wahrheit viel mutiger sind, als wir uns normalerweise zugestehen.
Sich vorm Schlafengehen um Versöhnung mit dem Partner bemühen, obwohl einem Zurückweisung droht; die Tränen nicht zurückhalten, obwohl man sich angreifbar macht, wenn man Gefühle zeigt; einer Freundin sagen, dass sie sich unmöglich aufgeführt hat: Wenn wir uns klarmachen, wie viel Mut so was erfordert, und wenn wir uns dafür loben – dann wächst uns vielleicht noch ein ganz anderer Mut, eine zupackende Lebenslust, der sich nichts mehr in den Weg stellen mag und die keine Rückbestätigung von außen braucht.