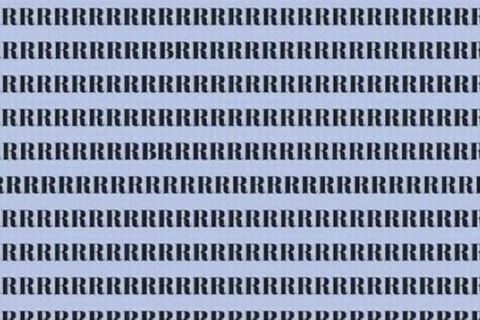Nach ein paar Sätzen klingt ihre Stimme am Telefon schon wieder ganz vertraut. Dabei haben wir seit 30 Jahre nicht miteinander gesprochen. "Ich hab noch Briefe von dir, von damals", sagt sie, "willst du die haben?" Ich habe inzwischen nie mehr an diese Briefe gedacht. Aber jetzt sehe ich die Situation wieder genau vor mir: Damals war ich Mitte 20 und stand kurz davor, mein Studium abzuschließen. Was danach kam, wusste ich noch nicht. Zum ersten Mal musste ich jetzt, unabhängig von Frauengruppe, WG oder Politverein, über meine Zukunft entscheiden. Berlin - dorthin war meine Freundin gezogen - war damals noch ziemlich weit weg. Weit genug, um jedenfalls noch in Briefen hemmungslos in Träumen, Zielen, Hoffnungen zu schwelgen. Denn damals wollten wir vor allem eins: alles ganz anders machen als alle Generationen vor uns.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass wir uns jetzt erst wiedergefunden haben.
Jetzt, wo wir endlich wieder dazu kommen, uns zu fragen: Was - und vor allem wer - ist daraus geworden? Haben wir die Welt verbessert, sind wir berühmt geworden, haben wir unser privates Glück gefunden? Welche verpasste Chance können wir vielleicht doch noch mal ergreifen, welchen ungelebten Traum verwirklichen? Und was müssen wir dafür über Bord werfen an lieb gewordenem Komfort und materiellen Gütern? Meine Freundin und ich haben dann erst einmal ein paar Mails hin- und hergeschickt. Natürlich mailen wir, und das, was wir uns jetzt schreiben, wird 30 Jahre später nicht mehr in irgendeinem Schuhkarton wiederzufinden sein.
"War ja nicht anders zu erwarten, bei den Voraussetzungen...", schreibt sie mir, nachdem ich von all den persönlichen und beruflichen Wendungen in meinem Leben erzählt habe. Und das finde ich jetzt viel interessanter als meine alten Briefe: Welchen roten Faden erkennt sie in meinem Leben, von dem ich vielleicht selbst nichts weiß?
Es ist eine schöne Vorstellung, dass es etwas Unverwechselbares gibt,
was uns durch alle Lebensphasen hindurch begleitet, wie unsere unveränderlichen Merkmale im Reisepass. Eine Identität. Und vermutlich suchen wir danach auch ein Leben lang. Als wir jung waren, war das noch ziemlich einfach. Wir hatten Vorbilder, politische Ziele, eine Weltanschauung - und die Geborgenheit einer Gruppe gab es oft fast automatisch dazu. Wenn wir den Lebensentwurf, den die Konvention für uns vorsah, nicht wollten, konnten wir uns in einer buntscheckigen Protestbewegung Gleichgesinnte suchen. Die passende Garderobe, die politischen Standpunkte, die Verhaltensregeln und das musikalische Begleitprogramm standen schon dafür bereit.
Wenn wir die K-Gruppen nicht mochten, gingen wir halt zu den Spontis. Und die Anti-AKW-Bewegung mit ihren fröhlichen, kämpferischen roten Sonnen hat uns dann alle aufgesogen. Die Bots spielten "Aufstehen!" dazu, mit einem wunderbaren niederländischen Akzent. Nur manchmal haben wir uns heimlich und leise gefragt: Und ich? Wie passt das zusammen mit dem, was ich ganz persönlich vom Leben will? Schon wenig später wurden diese Fragen sehr konkret. Wir mussten ständig Entscheidungen treffen, die Weichen für das weitere Leben stellen: für oder gegen einen Beruf, eine Stadt, einen Mann, ein Kind, eine Wohnung.
Meistens haben wir uns nur noch an den Bruchkanten des Lebens gefragt: Wer bin ich? Warum verliebe ich mich in diesen Mann, der so gar nicht zu meinen Zukunftsvorstellungen passt? Was tue ich, wenn der sicher geglaubte Arbeitsplatz plötzlich bedroht ist? Warum habe ich Angst, mich selbst zu verlieren, wenn eine Freundin an Krebs stirbt? Diejenige, die ich gebraucht habe wie die Luft zum Atmen, um mich über den komplizierten Alltag mit Männern, Kindern und Beruf auszutauschen - und darüber, wie wir darin bestehen?
Soziologen sprechen von "Patchwork-Identitäten",
um zu beschreiben, was uns im Laufe des Lebens immer wieder und immer mehr abverlangt wird: umzuschalten und uns noch mal auf etwas ganz anderes einzustellen. Uns immer wieder selbst neu zu erfinden - das hört sich gut an. Aber ehrlich gesagt wird uns diese Aufgabe ziemlich oft durch äußere Ereignisse aufgezwungen.
Zum Beispiel wenn wir uns von lieb gewordenen Menschen oder Räumen verabschieden müssen. Beim Packen der Umzugskartons fallen sie uns wieder in die Hände, die Fotos oder Briefe von damals - und gerade jetzt ist scheinbar der falsche Moment, um sich den Erinnerungen darüber hinzugeben, wie alles mal angefangen hat. Gerade dann, wenn das Leben uns richtig fordert, kommt uns die Frage nach unserem eigenen Persönlichkeitsentwurf eher wie ein Luxusproblem vor. Dabei ist es unsere Antwort auf genau diese Frage, die darüber entscheidet, ob wir noch im größten Schlamassel das Gefühl haben, unsere Geschichte selbst zu schreiben. Oder ob wir lediglich Statisten in einem Stück sind, dessen Drehbuch von anderen erdacht wurde.
Von einer "erarbeiteten Identität" spricht die Psychologie,
wenn es gelungen ist, eine Veränderung so zu bewältigen, dass wir sagen können: Das gehört zu mir. Ich bin daran gewachsen. Schade nur, dass bis heute kein Wissenschaftler so genau sagen kann, was Identität überhaupt ist. Denn diese Frage beschäftigt uns alle mehr denn je. "Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?": Von dem Buch mit diesem Titel wurden in zwei Jahren 800 000 Exemplare verkauft.
Sein Autor Richard David Precht bietet eine gut lesbare Einführung in die Philosophie - aber keine Antwort. Und ebenso wenig tut das die Hirnforschung. Zwar bescheinigen uns die Wissenschaftler, dass wir unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können, solange wir leben - das Gehirn schafft dafür immer wieder neue Vernetzungen. Es hilft uns auch, uns unsere eigene Geschichte immer wieder neu zu erzählen, indem wir aus der Flut der Ereignisse, denen wir ausgesetzt sind, einen sinnvollen Zusammenhang konstruieren. Und weglassen, was einfach nicht zu passen scheint. Aber wer dieses ominöse "Ich" ist, das sich in unserem Kopf immer wieder neu kreiert - das wissen auch die Hirnforscher nicht. Das lässt sich mit keiner noch so raffinierten Hightech-Diagnostik erkennen. Diese Frage müssen wir schon selbst beantworten.
Nicht jedes Leben ist dafür gemacht, mit 50 noch mal neu entworfen zu werden.
Auch das Ungelebte gehört zu unserer Identität, sagt die Züricher Psychotherapeutin Verena Kast - wenn wir es uns bewusst machen und annehmen. Wenn wir uns etwa eingestehen, dass an uns keine große Musikerin, bildende Künstlerin oder Schriftstellerin verloren gegangen ist - aber dass Musik, Malerei oder Schreiben unser Leben bereichern können. Vielleicht in Zukunft sogar noch mehr als in der Vergangenheit, als wir alles, was wir taten, einer scharfen Kosten- Nutzen-Analyse unterwerfen mussten: Lohnt sich das? Verspricht es Erfolg?
Jetzt erst ist Zeit für einen fürsorglicheren Blick auch auf das, was uns nicht gelungen ist, vielleicht, weil es einfach zu schwer war. Vielleicht war es richtig, eine Karriere-Chance nicht zu ergreifen, nicht in diese andere Stadt zu ziehen, für diesen Mann nicht alles stehen und liegen zu lassen? Nicht immer ist das Wagnis die bessere Wahl, nicht immer öffnet sich damit die Tür zu einem aufregenderen, reicheren Leben. Nichts zwingt uns, die Träume, die wir nicht verwirklicht haben, abzuwerten oder verschämt zu vergessen - sie gehören zu uns wie unsere alltägliche Routine.
Es ist dieses Lebensalter, in dem sich manche entscheiden,
an den Ort zurückzugehen, an dem sie groß geworden sind. In dem alte Freundschaften wieder aufleben und plötzlich sehr wichtig werden. In dem sich neue Partnerschaften nicht selten auf Klassentreffen ergeben: Ist das nicht der Typ, an den ich mich in der 12. Klasse nie rangetraut habe? Ein bisschen angegraut und faltig ist er schon, ein bisschen mehr Bauch hat er auch, aber er ist immer noch interessant. Und jetzt erst gesteht er mir, dass er damals Taschenbuchunglücklich in mich verknallt war. Haben wir 30 Jahre miteinander verpasst? Nein, wir sind an etwas anderem gewachsen.
Nein, dies ist kein Aufruf dazu, mal so richtig schön "in uns zu gehen".
Sich selbst finden, die Suche nach der eigenen Identität - für mich ist es eine hehre Vorstellung, dass dies vor allem durch intensive Selbstbefragung auf einer einsamen Wanderung zu bewerkstelligen wäre. Ich jedenfalls brauche dafür nicht den Jakobsweg, sondern Interaktion, Erfahrung, Begegnung. Und jemanden, der zu mir sagt: Genau so herausfordernd und trotzig hast du schon in die Welt geguckt, als du vier Jahre alt warst. Denn das Unverwechselbare an uns ist oft das, was wir selbst am allerwenigsten erkennen können. Was also war diese Lebenslinie, die sich in den Augen meiner Freundin schon vor 30 Jahren bei mir abgezeichnet hat? Das will ich genauer wissen. Wir müssen uns demnächst mal treffen, unbedingt!