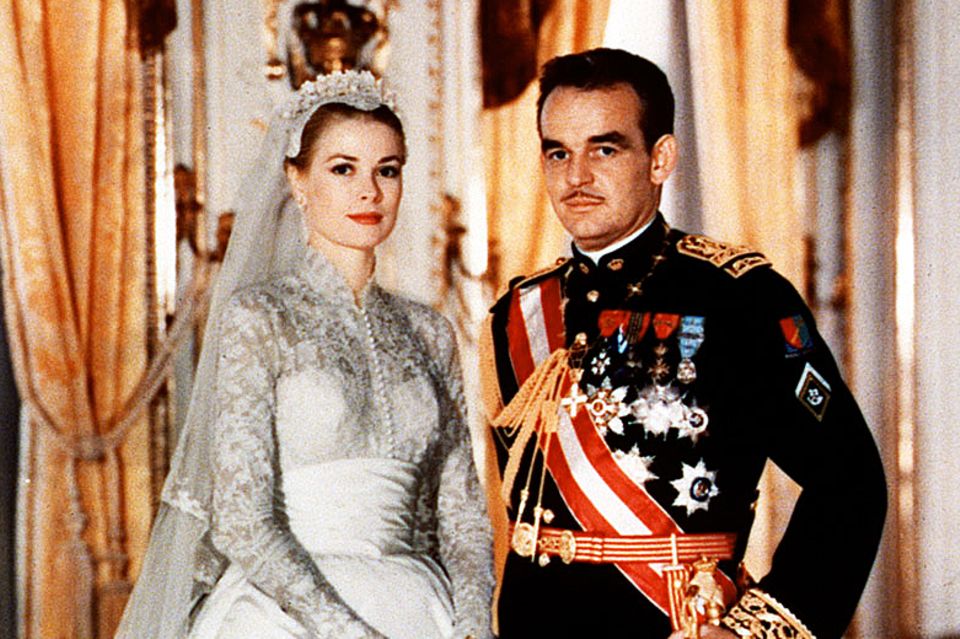Abendkleider aus angeschwemmtem Plastikmüll, PET-Flaschen, die zu Schuhen verarbeitet werden. Das klingt doch sehr fortschrittlich.
FRIEDERIKE PRIEBE: Das klingt, als ziehe man dem süßen Robbenbaby persönlich den Plastikstrohhalm aus der Nase, indem man solche Produkte kauft. Das kann durchaus an Verbrauchertäuschung grenzen.
Warum?
Wenn wir Plastik aus dem Ozean recyceln und zu Kleidung machen, haben wir das Problem nicht gelöst – das Plastik wird zwar noch einmal genutzt, doch früher oder später landet es wieder im Müll. Es ist nur ein Zwischenschritt, der den Abfall nicht reduziert. Das ist gutes Marketing, aber keine nachhaltige Lösung.
Tut aber auch niemandem weh, oder?
Na ja, einerseits wollen sich die Firmen damit ein Stück weit von dem Vorwurf freikaufen, Fast Fashion zu produzieren, also Klamotten, die nur eine gewisse Zeit getragen werden, dann im Müll landen und durch neue ersetzt werden. Andererseits verhelfen sie einem Polyester-Kleidungsstück, das bei vielen zu Recht an Ansehen verloren hat, wieder zu einem neuen, zweifelhaften Ruhm.
Alles landet am Ende als Plastik wieder im Müll
Ist gar nichts Gutes daran, Kleidung aus recyceltem Plastik zu kaufen?
Jedenfalls macht es die Ozeane nicht sauberer. Denn oft steht gar nicht genug recyceltes Ozeanplastik zur Verfügung. In Ländern wie Indien und China fehlt die Infrastruktur, um genug zu sammeln. Oft lässt es sich auch gar nicht recyceln, weil es zu verschmutzt ist oder nicht sortenrein. Gleichzeitig aber ist der Trend zu recyceltem Plastik so groß, dass Produzenten komplett neues PET nutzen, aber so tun, als wäre es recyceltes. Wieder andere Produzenten lassen sogar recyceltes Plastik aus Europa nach Asien einfliegen, dort zu Garn verarbeiten und schiffen das dann wieder nach Europa zurück. Entweder wird also zusätzliches PET für die Textilbranche produziert oder CO2-teuer extra eingeflogen. Alles landet am Ende als Plastik wieder im Müll. Und das Problem des Mikroplastiks wird dann auch noch vergrößert.
Wie kommt das?
PET ist ein fester Verpackungsstoff, da löst sich vergleichsweise wenig Mikroplastik ab. Wird es aber zu weichem Stoff, zum Beispiel zu Fleece verarbeitet, ist das ein loses Material. Die Folge: Jeder Waschgang spült bis zu 140 000 Mikrofasern ins Abwasser, aus denen sich das Mikroplastik bildet. Jeder Waschgang, immer und immer wieder. Das landet im Meer, in den Fischen, in unserem Magen. Wenn man PET-Flaschen zu Fleece recycelt, steigt der Mikroplastik-Eintrag also.
Nun werden ja nicht nur Shirts oder Kleider aus recyceltem Plastik gemacht, sondern auch Badeanzüge, die direkt auf der Haut sitzen. Inwiefern ist das ein Problem?
Das PET lässt sich zwar zu Textilfasern recyceln, die Fasern enthalten dann aber zum Beispiel Antimontrioxid, einen Katalysator, der nicht dafür bestimmt ist, stundenlang auf nackter Haut zu sein, da er krebs erregend ist. Und vielleicht haften an dem Plastik noch andere Dinge, von denen niemand etwas weiß, wenn man das Plastik aus dem Meer fischt. Plastik aus dem Ozean ist wie eine Blackbox. Will man das wirklich auf seiner Haut tragen?
Angenommen, die großen Labels wollen wirklich etwas gegen das Plastikproblem tun – was würden Sie ihnen raten?
Sie sollten ihre Produktion nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip ausrichten: Alle Produkte, die heute neu auf den Markt kommen, müssen so intelligent gemacht sein, dass all ihre Bestandteile restlos recycelt werden können - und gar nicht erst zu Ozeanplastik werden.
Am besten greift man zu Fasern wie Baumwolle, Wolle, Seide oder Leinen
Das klingt utopisch. Wie soll das umgesetzt werden?
Es muss digitale Schlüssel wie etwa QR-Codes an den Produkten geben, damit klar erkennbar ist, welche Inhaltsstoffe sie enthalten. So können die Materialien wieder zum Hersteller oder Wiederverwerter zurückfinden. Die Modemarken müssen ihre Lieferanten dazu auffordern, ihre Produkte so zu optimieren, dass sie kreislauffähig sind, ob Nähgarn, Stoffe oder Farben. Die Technik ist ja längst da. Ebenso gibt es bereits etablierte Rückhol- und Leihsysteme, etwa Kilenda, Stay Awhile oder MUD-Jeans.
Und was können wir als Modekonsument*innen direkt tun?
Wer Kleidung möchte, die definitiv keinen Abfall hinterlässt, sollte nach dem "Cradle to Cradle"-Siegel suchen. Wer auf Eco-Fashion setzt, kann auf die Symbole „GOTS“ oder "bluesign" achten, sie gelten als streng und gut kontrolliert, sagen aber nichts über die Recyclingfähigkeit eines Produktes aus.
Und wenn man kein zertifiziertes Kleidungsstück findet oder einfach nicht das Geld dafür hat?
Dann sollte man wenigstens auf das Material achten. Wer Mikroplastik vermeiden will, lässt Fleeceprodukte aus Polyester oder Polyacryl liegen. Kleidung aus recyceltem Nylon ist deutlich besser, das ist einer der wenigen Kunststoffe, die sich wirklich zur Wiederverwertung eignen. Noch besser ist es, zu natürlichen Fasern wie Baumwolle, Wolle, Seide oder Leinen zu greifen. Die sind meistens biologisch abbaubar, also kreislauffähig.
Spielen wir mal Utopie: Wenn die Modeindustrie wirklich alle Schadstoffe aussortieren würde, welche Produkte müssten dann aus den Regalen verschwinden?
Gar keine! So gut wie alles lässt sich heutzutage ersetzen, auch wenn es vielleicht mal ein Jahr dauert, bis irgendein kreislauffähiges Neonpink entwickelt ist. Die Nachfrage an die Lieferkette muss bloß hoch genug sein. Deshalb sollten die großen Modehäuser vorangehen.