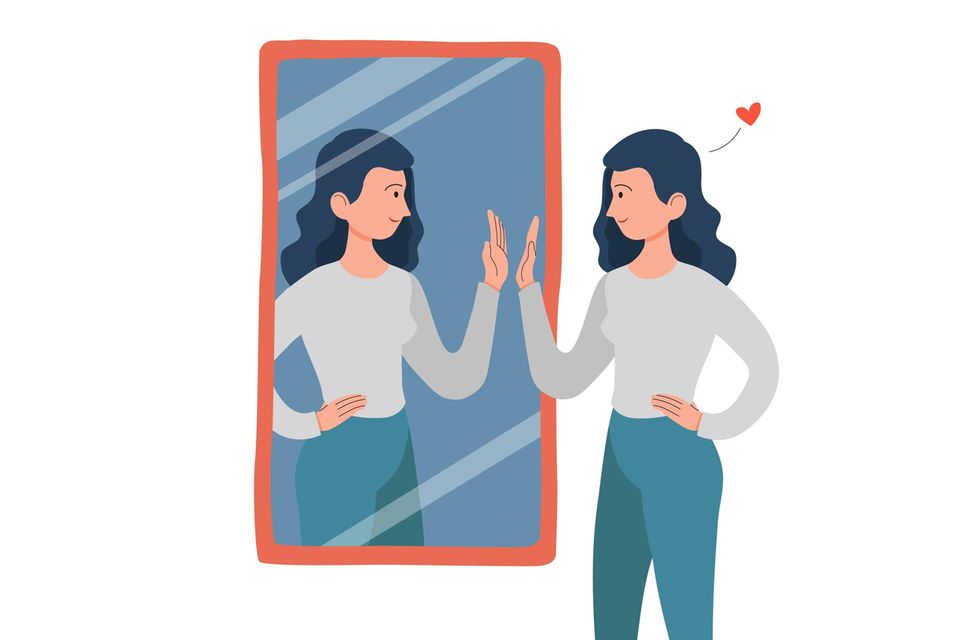Es ist 32 Jahre her. Ich habe mich daran gewöhnt. Aber die Trauer ist geblieben. An einem Tag im April 1986 starb mein Vater. Er war 57 Jahre alt. Ich war 34. Und plötzlich in einem anderen Leben. Jetzt wusste ich, was Schmerz ist, was Verlust bedeutet, wie stark ich sein muss. Der sogenannte Ernst des Lebens - hier hat er begonnen. Und dann nie wieder aufgehört. Ich war wütend. Ein Mensch, ein durch und durch wunderbarer Mensch, den ich, den viele brauchten, wurde vom Schachbrett genommen. Und das Spiel ging einfach weiter. Finster sah ich jeden älteren Mann auf der Straße an, ich dachte: Du darfst leben! Weißt du überhaupt, was für ein Glück das ist? Bist du auch nur annähernd so lieb, so weise und lustig, wie mein Papa es war?
Was tröstet – und was nicht!
Trost gab es keinen. Es hat auch keiner versucht damals. Meine Mutter und mein Bruder hatten ihre eigene Trauer. Es war die Zeit, in der man noch nicht so viele Worte um Gefühle machte. Und das Leben ging weiter. Musste ja.
Gibt es Trost überhaupt? Was soll das sein? Diese Hülle aus fünf Buchstaben. Wer oder was kann wirklich Trost spenden? Verena Kast, die Schweizer Psychoanalytikerin, die sich mit den Phasen des Trauerns beschäftigt hat, weiß auch keine Patentantwort. Nur so viel: Wenn einer sagt, in einem halben Jahr sieht die Welt wieder anders aus, möchte sie demjenigen „am liebsten ins Gesicht springen“. So etwas nennt sie "billigen Trost".
Es gibt diese Dinge, die in schweren Zeiten guttun. Wenn ich vom Fahrrad gefallen war und mir das Knie aufgeschürft hatte, half ein Pflaster. Meine Oma pustete drauf und sagte: "Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Sonnenschein, dann ist alles wieder gut." Ich habe gekichert, bin aufs Rad gestiegen. Und weiter ging’s. Nur dass später im Leben eben Schlimmeres passiert als Schürfwunden auf Sand.
Das persönliche Tschernobyl kommt irgendwann auf fast jeden von uns zu. Es ist paradox, aber allein dieses Wissen enthält schon eine Menge Trost. Denn das Schlimmste, was Enttäuschung und Verlust in uns auslösen, ist das Gefühl der Trennung - von allen anderen, denen es gerade gut geht, die keine Ahnung haben, die einfach so weitermachen. In dem Moment wähnt man sich furchtbar allein. Und braucht mehr denn je: Verbundenheit.
Wohin mit der Trauer?
Jahrhundertelang war für den Trost einzig die Religion zuständig. Und die, die sich nicht an Gott wenden konnten oder wollten, fühlten sich allein. Gerade unsere Generation.
- Von wem hätten wir lernen sollen, wie es ist, echten Trost zu spenden?
- An wen konnten wir uns selbst in schweren Stunden wenden?
- An die kriegsgebeutelten Eltern, wenn sie denn noch am Leben waren?
- An die Freundinnen hinter den perfekt gestutzten Gartenhecken?
Krankheit, Verlust oder gar Eheprobleme hatten lange keinen Ort, an dem sie ausgesprochen werden durften. Teilweise ist das heute noch so. "Damit werde ich schon allein fertig." Therapieangebote, die von den jungen Menschen heute wie selbstverständlich in Anspruch genommen werden, sind jenseits der 60 auch heute noch tabu.
Ich brauche keine psychologische Beratung, ich bin doch nicht verrückt!
Tapferkeit, Stärke und Wettbewerb waren in unserer Erziehung lange höhere Werte. Das Unglück - ob eigen oder fremd - machte uns unbeholfen. Und während die moderne Psychologie bereits das Phänomen der Über-Empathie entdeckt, muss unsere Generation erst einmal üben, das eigentlich Empathische auszudrücken, es zuzulassen und auszuleben.
Was sagen, wenn die Freundin nach 40 Jahren vom Mann verlassen wird? Wenn Krebs ihren Liebsten holt? Oder bei ihr selbst diagnostiziert wurde? Welcher Trost ist wirklich gut und welcher nur gut gemeint?
Das Schlimmste ist: "Kopf hoch, wird schon wieder." Gefolgt von: "Du schaffst das. Du hast schon ganz andere Sachen geschafft." Genauso schmerzvoll der Vergleich: "Du, ich kenne das, bei mir war das so ..." Oder: "Was soll ich denn sagen, ich bin schon so lange allein."
Das klingt leider wie eine Aufforderung an der Supermarktkasse. Stell dich hinten an beim Jammern. Solche Floskeln sind hilflos. Und verbreiten nur noch mehr Einsamkeit. Die Betroffene fühlt: "Ich werde nicht verstanden. Ich falle anderen zur Last. Alle wollen, dass ich schnell wieder funktioniere. Nur, wie soll das gehen, wenn man vor Unglück ganz taub ist? Und nichts mehr einen Sinn ergibt?" Viele sagen dann großzügig: "Melde dich jederzeit. Ich bin immer für dich da."
Verstehen sie denn nicht, dass das zu wenig ist? Wenn man zu gelähmt ist, um überhaupt an existenzielle Abläufe wie Essen oder Schlafen zu denken. Geschweige denn daran, bei seinen Freunden den Bittsteller spielen zu müssen? Warum kommen sie nicht einfach vorbei, halten die Hand, nehmen in den Arm und halten die Tränen einfach aus? Wortlos, ohne Kommentare und Ratschläge.
Was gegen die Trauer wirklich hilft
Der beste Trost, den ich je erlebt habe, war sehr tatkräftig. Ich schrie ins Telefon: "Ich habe Krebs!" Und meine beste Freundin schrie zurück: "Nein! Nein! Nein!" Dann fasste sie sich und sagte: "Ich hole jetzt deine Befunde von deiner Ärztin, faxe sie meinem Bruder und der kümmert sich um alles Weitere." Sie handelte blitzschnell. Sie übernahm Verantwortung. Ich war ab sofort nicht allein mit dem gesundheitlichen Worst Case. Und genauso wurde es gemacht.
Der Bruder, Chefarzt in einer großen Klinik, wurde mein Schutzpatron. Ich wurde wieder gesund. Meine Freundin hat nie gesagt: "Kopf hoch." Oder: "Das wird schon." Die war einfach nur da. Großartig. Manchmal muss man selbst mutige Präsenz zeigen. Und über seinen Schatten springen.
Es ist nicht lange her, da saß ich am Bett eines Freundes, der nicht mehr lange zu leben hatte. Ich wusste nicht, ob ihm das wirklich klar war, und ob er darüber reden wollte. Ich fragte: "Hast du Angst?" Das war vage genug und ließ ihm die Wahl, auszuweichen oder sich fallen zu lassen. Er sagte: "Klar habe ich Angst. Ich hätte gern noch zwei, drei Jahre gehabt." Dann schwiegen wir. Und weil ich nicht ging, obwohl mir die Situation nicht geheuer war, kamen wir auf die Dinge zurück, über die wir früher immer gelacht hatten. Erinnerungen aus der Studienzeit, Love, Peace und Rock’ n’ Roll.
Wenn ich an ihn denke, sehe ich ihn immer noch lachen. Aber was ich auf der Beerdigung seinen Söhnen sagen konnte, war nicht viel. Mehr als da zu sein geht manchmal nicht - weil man bei Unglücken der ganz großen Art selbst Trost gebrauchen könnte.
Es ist in Ordnung nichts tun zu können
So banal das ist, es hilft, diese Hilflosigkeit zuzugeben: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll." Ein guter Satz. Manchmal kann man auch einfach nichts Sinnvolles aus dem Ärmel schütteln. Und sollte es dann auch nicht. Hilft auch viel besser als "Ich weiß genau, wie du dich fühlst." Weiß man meist nämlich nicht. Und muss man auch gar nicht.
Eigentlich seltsam, dass wir uns mit wirksamem Trost so schwertun. Haben wir doch eine Trost-Automatik bereits serienmäßig eingebaut. Dr. Werner Bartens, Arzt und Autor, beschreibt Empathie als "automatische Reaktion, eine Art Reflex". Seelische Schmerzen aktivieren die gleichen Hirnregionen wie körperliche. Beobachten wir also, dass andere Menschen physische Schmerzen erleiden oder auch seelische Qualen, werden auch bei uns die Schmerzzentren aktiviert. Darum eilen wir automatisch zu Hilfe, wenn Trost gebraucht wird.
Zwar sei dieser Reflex bei vielen Menschen von negativen Gefühlen wie Stress, Wut, Ärger oder Angst überlagert. Wir denken uns vielleicht: Was kann ich mit meinen Worten schon ausrichten. Doch was wir uns vor Augen führen müssen: sehr viel. Mitgefühl ist tatsächlich ein echter Schmerzkiller. Bartens schreibt in seinem Buch "Empathie, die Macht des Mitgefühls": "Der Schmerz lässt nach, wenn ein einfühlsamer Mensch nicht nur sein Bedauern ausdrückt, sondern auch glaubhaft Mitgefühl zeigt." Und das Beste daran: Mitgefühl hilft nicht nur dem Leidenden, auch der Mitfühlende hat etwas davon. Es ist ansteckend, sagt auch der britische Psychologe Paul Gilbert. Tröstet man jemanden, wird nicht nur das Trostsystem des Unterstützten aktiv, auch der Tröster fühlt sich gestärkt. Das Gehirn schütte dann beruhigende Botenstoffe aus. Und man fühlt sich quasi mitgetröstet.
Mitgefühl kann die Wunden der Trauer heilen
Politiker müssen von Amts wegen tröstende Worte finden, wenn Katastrophen ein Land erschüttern. Ein Lkw rast in eine Menge, ein Flugzeug stürzt ab. Das geht alle an. Denn jeder hätte betroffen sein können. Das gemeinsame Sicherheitsgefühl ist gestört. Aber für die meisten nur einen Moment lang. Dann hat der Alltag uns wieder. Im Elend bleiben die sitzen, die einen persönlichen Verlust erlitten haben.
Anteilnehmende können nur ahnen, was Betroffene brauchen. Immer frage ich mich, wenn wieder etwas geschehen ist, ob Kerzen, Blumen und Teddybären an der Stelle des Unglücks den Tieferschütterten wirklich ein Trost sind. Und ob sie eigentlich gern "Opfer" genannt werden. Das Wort trennt die, denen etwas zugestoßen ist, von den Verschontgebliebenen. Diese Trennung tut zusätzlich weh. Deswegen gibt es Trauerrituale, Benefizveranstaltungen, Spendenläufe. Sie sollen ein großes, gemeinsames Gefühl der Verbundenheit schaffen. Die niederländische Psychologin Claartje Kruij weiß aber auch, dass dieses Gefühl schnell verschwindet.
"Wir leben in einer Zeit der Ad-hoc-Gemeinschaften. Es gibt Momente intensiver Unterstützung, die schnell wieder vergehen."
Das heißt für Trostbedürftige: Stärke ziehen aus den guten Momenten und - so klischeehaft das klingen mag - sich dauerhaft selbst trösten. Eine Lösung, die auch in unsere Zeit passt.
Selbstmitgefühl ist längst anerkannt als eine gesunde, stärkende Haltung. Nicht zu verwechseln mit Selbstmitleid. Nicht um Larmoyanz geht es dabei, um ein Sich-Suhlen im eigenen Leid. Sondern darum, gut zu sich zu sein - vielleicht der nachhaltigste Trost, den es geben kann. Herausfinden, was ich im Hier und Jetzt brauche. Ein gutes Essen vielleicht, das die Seele wärmt? Warum nicht. Ein Rotweinabend mit der Freundin? Wunderbar. Oder einfach eine durchgeweinte Nacht, in der Hoffnung sich nach dem Katharsiseffekt, also der reinigen Wirkung der Tränen, ein Stückchen besser zu fühlen. Auch gut, wenn eine Reise oder ein Tapetenwechsel auf Zeit neuen Abstand zum schmerzlichen Ereignis bringen. Claartje Kruij : "Manchmal fühlt man sich als Mensch verloren. Dann hilft es, wenn man innerlich berührt wird, wenn sich die eigenen Sehnsüchte mit etwas Äußerem verbinden."
Trost kann Trauer erträglicher machen
So gesehen ist Trost manchmal ganz in der Nähe. In großartiger Kunst zum Beispiel. Oder in einem Roman, der den Blick weitet. Wer die Berührung mit etwas Größerem als dem eigenen Schicksal zulässt, den tröstet es vielleicht, zu einer Menschheit zu gehören, die außer dem ganzen Mist um einen herum auch so etwas wie Bach oder Michelangelo hervorgebracht hat. Doch Vorsicht. Diese Sicht darf niemand erwarten. Sie kann versöhnen - oder ein Hohn für den Verletzten sein. Trauer und Trost sind so verschieden wie unsere Lebenswege.
Vielleicht sind wir erst dann gute Tröstende, wenn wir verstanden haben, was uns selbst hilft. Die Trauer endet damit nicht. Sie endet nie. Aber Trost kann sie dämpfen, erträglich machen und helfen, sie ins Leben einzubauen. Mich tröstet der Blick aufs Meer - für meinen Vater, für alles, was danach kam. Wenn ich das Meer sehe, höre, rieche, schweigen alle Fragen nach dem Sinn. In dem Moment sind da nur Schönheit, Ewigkeit, Unendlichkeit. Hinterm Horizont geht es weiter. Kitsch? Na und! Wenn es tröstet.