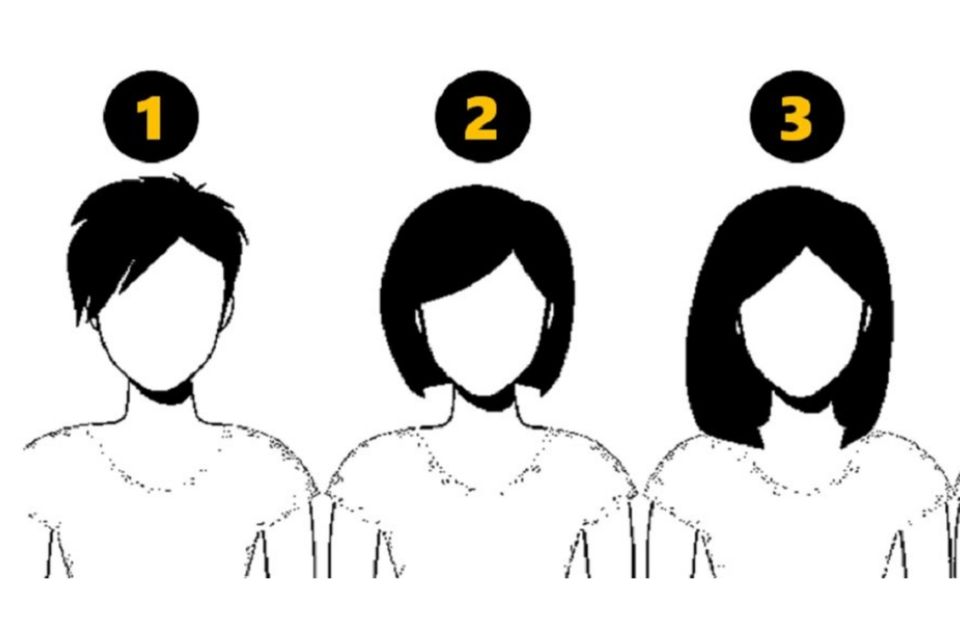Meine Mutter starb am 31. Oktober, zwei Tage vor dem Día de los Muertos. Und zehntausend Kilometer weit entfernt. Die Pandemie hat es mir verunmöglicht, sie noch einmal zu sehen. Doch als ich am Morgen nach ihrem Tod das bunte Seidenpapier für ihren Altar zurechtschnitt, fühlte ich mich ihr sehr nahe. Der Día de los Muertos, der Tag der Toten, ist der höchste mexikanische Feiertag, das wichtigste Fest für meinen Mann – und unterdessen auch für mich. Victor ist mexikanischer Ureinwohner vom Stamm der Nahua, ein traditioneller Conchero und in allen Zeremonien und Ritualen ausgebildet. Nach und nach habe ich diese mir anfangs so fremde Tradition angenommen, einfach weil sie so wohltuend und tröstlich ist.
Der Tod ist nicht das Ende vom Leben
Die mexikanische Kultur geht von einer ganz einfachen, aber radikalen Annahme aus: Der Tod ist nicht das Ende. Im Gegenteil: Nach dem Tod geht es erst richtig los. Der Tod ist Teil des Lebens, und das sind auch die "Muertitos" die geliebtenVerstorbenen. Wenn wir sie nach allen Regeln der Kunst umwerben und einladen, dann kommen sie uns einmal im Jahr sogar besuchen, eben am 2. November, an ihrem besonderen Festtag. In der mexikanischen Vorstellung enden Beziehungen nicht mit dem Tod, sondern erst mit dem Vergessen.
Victor hat mir eine Schablone vorbereitet, einen reich verzierten Totenkopf, der den Namen meiner Mutter trägt. Sorgfältig folge ich den Verästelungen mit dem Japanmesser, schneide durch die Papierschichten in den Lieblingsfarben meiner Mutter. Ich bin nicht besonders geschickt, ich arbeite den ganzen Tag. Es ist, als ob ich den Tag mit meiner Mutter verbringe. Anfangs berührten mich die vielen Totenkopfporträts in Victors Atelier eher seltsam. Doch in Mexiko knabbern schon kleine Kinder an den Zuckerschädeln, die erst noch ihre Namen tragen. Für meine europäischen Augen waren solche Szenen verstörend, vor allem, da ich auch noch abergläubisch bin. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto natürlicher erschien es mir. Das Einzige, was wir mit absoluter Sicherheit wissen, ist, dass wir sterben werden. Je eher wir uns an den Gedanken gewöhnen, desto weniger Angst macht er uns. Je mehr wir den Tod im Alltag integrieren, desto weniger Macht übt er über uns aus. Und wenn wir den Tod nicht fürchten müssen, wird das Leben sofort unendlich viel leichter.
Mein Mann ist schwer krank. Seine Patientenakte ist so dick wie ein Telefonbuch. Als wir uns kennenlernten, hatte er bereits mehrere Schlaganfälle, Herzinfarkte, Nierenversagen, acht Jahre Dialyse, eine Nierentransplantation und zwei Monate Koma hinter sich. Seit wir zusammen sind, hatte er eine Hirnblutung, mehrere Lungenentzündungen, diverse Herzoperationen, die dazugehörigen Komplikationen und zwischendurch noch ein paar Unfälle. Niemand weiß, warum er noch lebt – geschweige denn so gut gelaunt ist. Wir waren ein paar Jahre lang befreundet, bevor ich mir erlaubte, mich in ihn zu verlieben. Die Angst, ihn gleich wieder zu verlieren, war zu groß. Doch die Liebe zu Victor hat mir gleichzeitig auch einen Schlüssel zum Umgang mit dieser Angst geschenkt. Seine Tradition ist nicht meine, aber sie tröstet mich.
Party im Jenseits
Victor hat nicht die geringste Lust zu sterben. Aber wenn es so weit ist, hat er bereits eine ziemlich lange Liste von Frauen, mit denen er im Jenseits gern anbandeln würde. Denn im mexikanischen Paradies geht es erstaunlich weltlich zu, es ist eine Art ewige Fiesta mit Tanz und Musik, sprudelnden Tequilaquellen und mundgerechten Peyotehappen. Und geflirtet wird offenbar auch. Ganz oben auf Victors Liste steht Sophia Loren. "Die lebt aber noch", sage ich.
Wenn ich Victor irgendwo aus den Augen verliere, bei einer Party, in einer Ausstellung, dann suche ich einfach die größte Traube lachender Frauen. Zuverlässig finde ich ihn in ihrer Mitte. So wird es also im Jenseits auch sein. Wenn ich nach ihm sterbe, suche ich einfach eine Gruppe lachender Skelette, und da werde ich ihn finden. Vielleicht werde ich Sophia aus dem Weg boxen müssen. Die Vorstellung bringt mich zum Lachen. So wird der Gedanke an Victors Tod – und auch an meinen eigenen – zu einem tröstlichen. Er heitert mich auf, statt mich verzweifeln zu lassen.
Was nicht heißt, dass ich dann nicht trauern werde. Was nicht heißt, dass Mexikaner nicht hingebungsvoll trauern. Aber sie trauern um sich, um ihren Verlust, nicht aber um den Verstorbenen, der diese schöne Welt verlassen musste. Das nimmt der Trauer eine schwere Schicht.
Oder ist der Tod doch das Ende von allem?
Meine Mutter haderte mit ihrer Sterblichkeit. Die letzten Jahre ihres Lebens waren davon überschattet: "Auch wenn ich noch zehn Jahre lebe, ist das nicht viel", sagte sie. "Es ist nicht genug." Jedes Mal, wenn wir uns sahen, drohte sie mir, das sei bestimmt das letzte Mal. Ich hatte ihr vom Día de los Muertos erzählt. "Falls du vor mir sterben solltest", versprach ich ihr diplomatisch, "werde ich dir einen richtig schönen Altar errichten." Doch das tröstete sie wenig. "Na, wenn’s dich glücklich macht …", sagte sie. "Ich hab ja dann nichts mehr davon." Sie war der festen Überzeugung, dass der Tod das Ende von allem ist. Dass danach nichts mehr kommt. Dass nur dieses eine Leben hier, auf der Erde, zählt.
Während ich das Papier schneide und auch noch, als ich den Altar errichte, meine ich, ihre Skepsis zu spüren. Doch später, als zwei Freundinnen vorbeikommen und ich die Lachsbrötchen herumreiche, die meine Mutter so gern gegessen hat, und den Champagner einschenke, für den sie immer einen Grund gefunden hat, entspanne ich mich. Meine Freundinnen verteilen sich in unserem Wohnzimmer, das sonst an diesem Tag aus allen Nähten platzt. Unsere mexikanischen Freunde feiern den Tag zu Hause, aber unter den Amerikanern und Europäern herrscht ein großes Bedürfnis nach Ritualen. Oder einfach nach Gesprächen. Über den Tod, das Sterben, über die Trauer, über unsere Muertitos. Auf unserem Altar ist deshalb immer Platz für viele Bilder. "Alle Toten sind willkommen", sagt Victor und hängt noch eine Laterne ins Fenster.
Theresa hat dieses Jahr ihre Zwillingsschwester verloren, Stephanie ihren Sohn. Er ist beim Frühstückmachen tot zusammengebrochen. Ihre Trauer ist roh und gewaltig, sie ist eine Tsunamiwelle. Die Rituale des Día de los Muertos machen die Trauer nicht kleiner. Sie machen sie nicht weg. Im Gegenteil: Sie würdigen die Trauer, sie geben ihr einen Platz. Und vor allem lassen sie uns nicht mit ihr allein. "Ich will nur seinen Namen hören", sagt Stephanie. "Niemand spricht mehr seinen Namen aus. Als ob es ihn nie gegeben hätte." Ihre Nachbarin weiche ihr aus, aus Angst vor ihrer Trauer, ziehe die Wohnungstür schnell zu, wenn sie den Flur betrete. Das ist nicht böser Wille, das ist Hilflosigkeit. Wie sollen wir mit dem Tod umgehen können, wenn wir ihn so krampfhaft verdrängen? In Mexiko feiert man auf dem Friedhof, man breitet ein Picknick aus, Kinder spielen zwischen Grabsteinen. "Der Friedhof ist ein glücklicher Ort, weil man da mit den Muertitos zusammen ist", sagt Victor. "Und wie bei jedem Verwandtenbesuch zieht man sich schön an und bringt etwas Feines zu essen mit." Spielende Kinder auf dem Friedhof? Nein, das gab es in der Schweiz, in der ich aufgewachsenen bin, nicht.
Am Día de los Muertos werden die wahren Geschichten ausgepackt
"Meine Schwester war eine fürchterlich schwierige Frau", sagt Theresa. "Sie hat sich mit allen verkracht, auch mit mir. Aber sie fehlt mir. Als ob mir ein Arm abgehackt worden wäre." Ich nicke. Meine Mutter war auch nicht die einfachste aller Mütter. Und es tut mir gut, das aussprechen zu können. Am Día de los Muertos werden die Verstorbenen mit Geschichten gewürdigt, aber diese Geschichten sind nicht beschönigt. Die Muertitos werden nicht automatisch in den Heiligenstand erhoben, sie werden geneckt und herausgefordert, man setzt sich mit ihnen auseinander, wie man es im Leben tat. Die Beziehungen gehen schließlich weiter. Und die Muertitos müssen sich in unseren Erzählungen wiedererkennen. Diese künstliche Ehrfurcht, die ich gewohnt war, schafft nur unnötige Distanz.
Während ich über meine Mutter rede und auf sie anstoße, macht sich plötzlich eine ungekannte Ruhe in mir breit. Als hätte sich auch meine Mutter entspannt. Ich stelle mir vor, dass sie in ihrem Paradies angekommen ist, wie immer das aussehen mag. Ich habe das Gefühl, sie sei … glücklich. Ob ich mir das einbilde oder nicht, ich fühle mich getröstet und versöhnt. "Niemand kann wirklich wissen, was nach dem Tod passiert", sagt Victor. "Wir haben uns einfach für die schönste, die tröstlichste Version entschieden. Und wenn wir nach dem Tod feststellen, dass es dieses Paradies gar nicht gibt ...? Na, dann haben wir wenigstens das Leben genossen!"
Zum Weiterlesen
Noch mehr erleichternde und unterhaltsame Erkenntnisse über Tod und Leben finden sich in Milena Mosers Buch "Das schöne Leben der Toten. Vom unbeschwerten Umgang mit dem Ende" (172 S., 19 Euro, Kein&Aber)