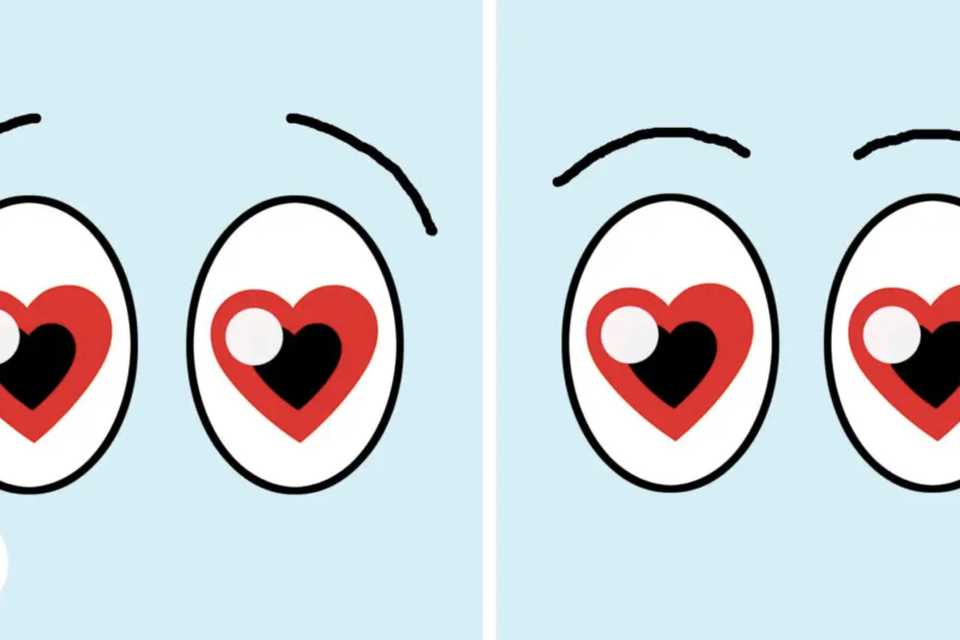Vor einiger Zeit war ich zum ersten Mal im Metropolitan Museum of Art in New York City. Ich bin keine Museumsgängerin, weil ich mich viel lieber draußen aufhalte als drinnen, und habe keine Ahnung von Kunst. Aber das Met! Das, dachte ich, könnte ich mir einmal anschauen, wenn ich schon die seltene Gelegenheit dazu habe. Was ich allerdings nicht dachte, ist, dass mich dieser Museumsbesuch so tief beeindrucken und berühren würde, dass er wahrscheinlich noch lange eine besondere Erinnerung für mich sein wird.
Picasso wer?
Für alle, die ein ähnlich beschränktes Kunstinteresse haben wie ich: Im Metropolitan Museum of Art sind zahlreiche Werke weltberühmter Maler:innen ausgestellt. Monet, Matisse, Van Gogh, Picasso, hier tummeln sich all die großen Namen, die sogar wir Banaus:innen zumindest schon einmal gehört haben. Raum für Raum, Gemälde für Gemälde habe ich mir nun die Ausstellungsstücke der oberen Etage – ich betitele sie mal mit "Malerei" – angeschaut. Ich habe versucht, mich ihnen zu öffnen, sie auf mich wirken und mich auf sie ein zu lassen. Einige Werke haben mich mehr angesprochen, andere weniger. Einige fand ich schön, andere nicht. Nur eines, muss ich zu meiner Schande gestehen, hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen: Van Goghs Selbstportrait mit Strohhut. Wie ich schon sagte: Keine Ahnung von Kunst.
Die rührende Rüstung
Ein völlig anderes Erlebnis hatte ich wiederum im Erdgeschoss des Museums. Hier sammeln sich Skulpturen und Kulturgegenstände aus den letzten sechs Jahrhunderten. Kalksteinstatuen von 1410. Bronzebüsten aus dem 16. Jahrhundert. Die Rüstung von König Henry dem VIII., die knappe 23 Kilogramm wiegt und die dieser Mann tatsächlich getragen hat. Viele der Ausstellungsstücke waren unvollkommen: Hier fehlte eine Nase, da eine Hand und hier und da war mehr verloren als erhalten. Obwohl mir nun kaum einer der Namen neben den Werken etwas sagte, stand ich oft staunend, zutiefst gerührt und teilweise minutenlang davor und spürte immer wieder, wie mir die Tränen in die Augen stiegen: Die Vorstellungen, die diese Kulturgüter in mir auslösten, überkamen und überwältigten mich mit voller Wucht. Ein Mensch, der wochenlang an einem Block Kalkstein herumwerkelt hatte, um daraus die Jungfrau Maria zu bilden. Der in einer Welt ohne Elektrizität oder Sneaker lebt, weder Pommes noch Aperol Spritz kennt. Fluten, Erdbeben und Schlachten, die diese Maria später über die Jahrhunderte ihre Nase, ihre Hand, aber nicht ihre Essenz gekostet haben, weil es immer jemanden gab, dem es wichtig war, sie zu bewahren. Mir kommen fast schon wieder die Tränen.
Eine ganze Weile hatte ich keine Idee, was ich im Erdgeschoss des Met gefunden habe, das mir in der oberen Etage gefehlt hat. Dann las ich ein paar Monate später einen Artikel bei "Psychology Today", der mich auf eine gebracht hat: Zu den Gemälden hatte ich (aufgrund meiner fehlenden Bildung) keine Geschichten, zu den Skulpturen schon (durch eine Mischung aus Fantasie und Geschichtswissen).
Experiment: Vermeintlich teurer Wein macht mehr Spaß
In besagtem Artikel beschäftigt sich die Autorin mit der Frage, warum uns Fälschungen weniger begeistern als Originale. Sie beschreibt darin unter anderem ein Experiment, bei dem die Versuchspersonen Wein zu trinken bekamen, dazu jedoch unterschiedliche Infos erhielten: In einem Fall hieß es, dass es sich um einen besonders teuren Wein handelte. Im anderen Fall sollte es irgendein beliebiger Wein sein. Hirnscans zeigten dann, dass unter der ersten Voraussetzung – die Leute glauben, einen teuren Wein zu trinken – eine Region im Gehirn aktiv wird, die uns Freude und Genuss spüren lässt, wenn wir etwas erleben. Orbitofrontaler Cortex heißt diese Region. Unter der zweiten Voraussetzung – die Versuchspersonen wussten nichts über den Wein – beobachteten Wissenschaftler:innen keine Aktivität. Dabei war es in beiden Fällen der gleiche Wein.
Fazit
Wie dieser Versuch illustriert mein Besuch im Met, wie sehr sich das, was sich in unseren Köpfen abspielt, auf unsere Wahrnehmung auswirkt. Und nicht nur auf unsere Wahrnehmung: Auf unser Erleben. Über Informationen und Wissen zu verfügen (erschreckender Weise unter gewissen Umständen sogar egal, ob wahr oder unwahr), bringt uns eine Sache näher, macht sie für uns attraktiver, kann uns in manchen Fällen vielleicht schon in die Lage versetzen, sie zu genießen und zu schätzen. Können wir aus unseren Informationen und unserem Wissen obendrein noch eine Geschichte bilden, die einen Sinn für uns ergibt, die uns etwas bedeutet, mit der wir uns identifizieren können, kann das aus einem simplen Gegenstand einen Schatz machen. So wie die Eulenfeder, die mein Vater jahrelang auf seinem Schreibtisch in einem Glas stehen hatte und die ich heute aus meiner brennenden Wohnung retten würde. Oder wie das Selbstporträt des Malers, der sich ein Ohr abgeschnitten hat, das Millionen von Menschen mit Gefühlen der Bewunderung, Liebe, Verbundenheit oder Schmerz erfüllt.
Alle Menschen haben unterschiedliche und zum Teil einzigartige Geschichten, die sie erzählen können. Und vielleicht könnten wir uns die Welt selbst ein bisschen schöner machen, indem wir sie miteinander teilen.
Verwendete Quellen: psychologytoday.com