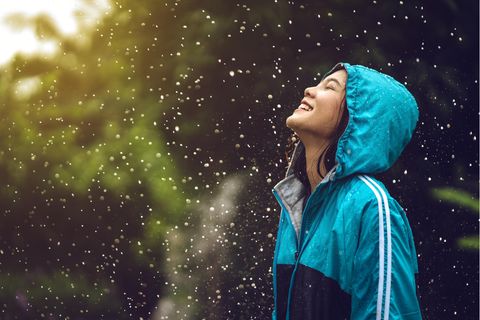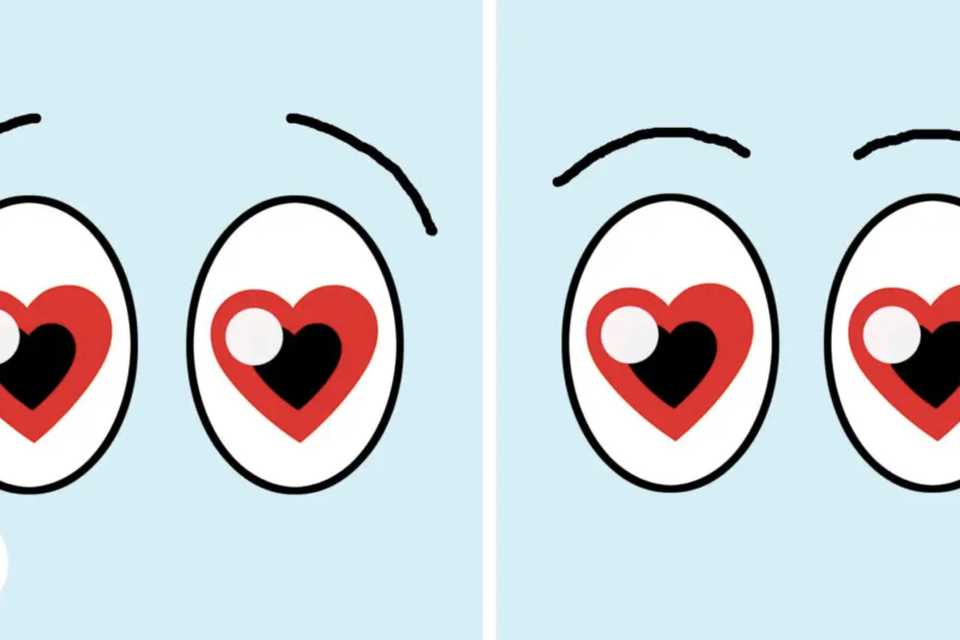Ein Baum, ein Hund, ein Auto. Ein Mann, ein Kind, meine beste Freundin. Eine Blondine, ein Asiate, ein Blatt, das vom Wind verweht wird. Sobald wir etwas aufmerksam wahrnehmen, ordnen wir es ein. Und von diesem Moment an können wir das wahrgenommene Objekt oder Wesen kaum noch unvoreingenommen und voraussetzungsfrei betrachten.
Mit allen Begriffen, die wir verwenden können, verknüpfen wir Attribute, die sie unter anderem voneinander abgrenzen. Zum Beispiel ist ein Baum für uns eher etwas Großes, Unbewegliches, mit grünen Blättern, einem Stamm und Ästen. Ein Hund läuft hingegen auf vier Beinen durch die Gegend, wedelt mit dem Schwanz und hat Fell. Sobald wir nun einen Baum als Baum erkennen, stehen in unserer Wahrnehmung die Attribute für uns im Vordergrund, die ihn zu einem Baum machen. Also beispielsweise seine Blätter und sein Stamm. Und nicht die Insekten, die auf ihm herumkrabbeln, oder die Beschaffenheit seiner Rinde oder Anzahl und Dicke seiner Äste. Wir reduzieren den Baum auf sein Baumsein. Einerseits.
Andererseits unterstellen wir dem Baum, dass für ihn gilt, was wir im Laufe unseres Lebens über Bäume gelernt haben: Dass er in seinen Blättern Fotosynthese betreibt, Wurzeln hat, die in die Erde reichen, im Winter gegebenenfalls seine Blätter abwirft. Wir fügen ihm also auch etwas hinzu, und zwar Informationen aus unserem Vorwissen.
Unser Gehirn macht das, ohne dass wir davon etwas mitbekommen. Und ohne dass wir es als anstrengend empfinden. Der Neurobiologe Professor Doktor Martin Korte erklärt: "Wir speichern Begriffe und die damit verbundenen Vorstellungen im deklarativen Gedächtnis des Gehirns, vor allem im Schläfenlappen." Dort befinde sich das sogenannte Wernicke Areal, das zu den großen Sprachzentren des Gehirns gehört.
Was können unsere Kategorien – und was nicht?
Anstatt über jeden Baum zu staunen und uns zu fragen, ob er gefährlich ist, können wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, zum Beispiel Kartoffeln kochen, ein Buch lesen, einer anderen Person die Haare schneiden oder eine Rakete bauen. Unsere Eigenschaft, zu kategorisieren, bietet uns somit einen Vorteil – und ist für uns eine Überlebensnotwendigkeit. Dem Baum werden wir mit unserem kognitiven Ordnungssystem allerdings nicht gerecht: Unser Begriff von einem Baum erfasst genau genommen keinen einzigen Baum auf dieser Erde in all seinen Details und seiner Individualität. Und das gleiche gilt für unsere Begriffe für Menschen.
Sobald wir Individuen in Kategorien einsortieren, sie darauf basierend auf bestimmte Attribute reduzieren und um andere ergänzen, tun wir ihnen unrecht. Mit jeder Zuweisung von Bezeichnungen wie Mann, Frau, Rentnerin, Handwerker, Brite oder Afrikanerin machen wir Annahmen, von denen wir nicht wissen, ob sie richtig sind. Wir machen es, müssen es tun, leben damit und können es auch – im Großen und Ganzen – sogar überaus erfolgreich. Allerdings gibt es noch etwas, was in Bezug auf unser kognitives Ordnungssystem erwähnenswert ist: Unser Gehirn bevorzugt sehr klare, sehr einfache Verhältnisse. Und um die herzustellen, werten wir, wo immer es geht: Wir unterscheiden zwischen gut und schlecht.
Warum wir nicht nur kategorisieren, sondern obendrein noch werten
"Wir neigen hinsichtlich unserer Wahrnehmung, unserer Urteile und unserer Einschätzung der Welt sehr stark zu einer Schwarz-Weiß-Einteilung", sagt Martin Korte. "Das erleichtert uns das Denken und ermöglicht uns, aus einer Unmenge an Daten das herauszufiltern, was uns letztendlich zu einer eindeutigen Ja-Nein-Entscheidung führt."
Die Tendenz zu einer Unterscheidung zwischen zwei gegensätzlichen Polen entspringt möglicherweise einem sehr ursprünglichen Interesse von Lebewesen: Die Sorge für das eigene Leben und das Vermeiden des Todes. Pflanzen und sogar weitaus einfachere Lebensformen nehmen den Unterschied zwischen Licht und Schatten wahr und reagieren darauf in lebenserhaltender Weise. Tiere unterscheiden zwischen Feinden und Freunden, Gefahr und Sicherheit, giftig und ungiftig. Zwar stellen wir nicht bei jeder Begegnung und jeder Entscheidung die Frage, an welcher Ecke wohl der Tod lauert und wo das Leben auf uns wartet. Doch in fremd und vertraut, bedrohlich und sicher, falsch und richtig ordnen wir ständig ein. Eine Skala mit zwei gegensätzlichen Polen und einer klaren Grenze in der Mitte ist sozusagen unser Go-To-Kategorisierungssystem. Weil wir damit im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte erfolgreich waren.
"In einer sehr schnelllebigen Zeit, in der es darauf ankommt, rasch Entscheidungen zu treffen, ist ein möglichst einfaches Orientierungssystem von Vorteil", sagt Martin Korte. "Wahrscheinlich ist nicht der Mensch unser Vorfahr, der sich eine Tabelle in den Sand gemalt und sorgfältig Für und Wider abgewägt hat, ob es wohl eine gefährliche Situation sein könnte, in der er sich befindet. Sondern es ist vermutlich derjenige, der ein schnelles Urteil gefällt hat und im Zweifelsfall erst einmal zur Seite gesprungen ist." So ordnen wir heute nicht nur alles, worüber wir nachdenken, in ohnehin schon nicht originalgetreue Kategorien, sondern sortieren es obendrein nach schwarz und weiß, schlecht und gut, Feind und Freund. Und nun lässt sich schon erahnen: Wer von sich behauptet, unvoreingenommen zu sein, weiß nicht allzu viel über sich selbst.
"Urteile und auch Vorurteile fällen alle Menschen, einschließlich hoch gebildeter Harvard-Professoren", sagt der Neurobiologe. "Die Frage ist nur, ob eine Person es sich eingesteht und darüber reflektiert oder ob sie meint, sie wäre dagegen immun." Aufweichen und verändern lassen sich unsere Kategorien nämlich – allerdings nur, wenn wir ihre Existenz anerkennen und bereit dazu sind, Aufwand und Anstrengung auf uns zu nehmen, um sie zu erweitern.
“Es ist die herausragende Leistung unseres Stirnlappens, dass wir über unsere Vorurteile und Urteile nachdenken und Unstimmigkeiten darin erkennen können", sagt Martin Korte. "Wir können schnell urteilen – ebenso aber langsam denken, hinterfragen und uns selbst gegenüber kritisch und reflektiert sein. Wir müssen uns dafür nur hin und wieder Zeit nehmen, aus unserem eigenen Schatten zu treten und uns selbst betrachten – eine Metafähigkeit die vielleicht nur die Spezies Mensch hat.“ Und gegenseitig könnten wir uns helfen, indem wir einander einen Spiegel vorhielten, so der Hirnforscher.
Fazit
Schnelle Urteile zu fällen und diese Urteile energiesparend für spätere Situationen zu speichern, ist eine Fähigkeit, die dem Überleben von Menschen jahrtausendelang diente und es heute noch tut. Zu zweifeln, Details und Feinheiten zu bemerken, Irrtümer zu erkennen und dazu zu lernen, ist eine ebensolche und vor allem dieser Fähigkeit verdanken wir Telefone, Penicillin, Live-Konzerte, Bücher und sonstige Annehmlichkeiten unserer Zivilisation. Beide Seiten werden immer in uns sein. Doch wir können Einfluss darauf nehmen, welche wir kultivieren.
Professor Doktor Martin Korte ist Neurobiologe und Leiter der Abteilung "Zelluläre Neurobiologie" an der Technischen Universität Braunschweig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem zelluläre Grundlagen von Lernen und Gedächtnis sowie Wechselwirkung zwischen Immunsystem und Gehirn bei der Entstehung der Alzheimer Erkrankung. In seinen Büchern "Frisch im Kopf", "Hirngeflüster“, "Wir sind Gedächtnis“ und "Jung im Kopf“ bereitet er Erkenntnisse aus der Hirnforschung alltagsrelevant und für ein breites Publikum auf. Fernsehzuschauer:innen kennen Martin Korte vielleicht aus der RTL-Quizshow mit Günther Jauch "Bin ich schlauer als …", für die er die Fragen entwickelte.