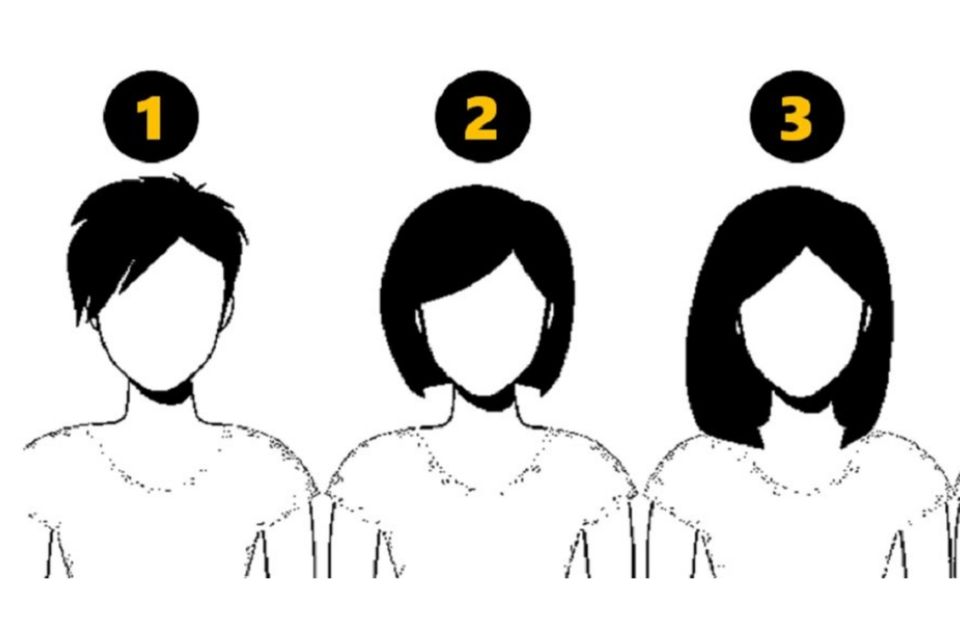Du hast sicher schon mal vom Placebo-Effekt gehört, also der Wirkung von Medikamenten, die eigentlich gar keine Wirkstoffe enthalten. Dabei geht es uns etwa plötzlich besser, weil wir glauben, dass eine Arznei uns hilft – und wir gar nicht wissen, dass sie in Wahrheit gar keinen medizinischen Effekt hat. Alleine die Erwartung einer positiven Entwicklung reicht, damit wir uns besser fühlen.
Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert der Nocebo-Effekt – so kann es nämlich passieren, dass wir plötzlich Symptome einer Krankheit spüren, die wir eigentlich gar nicht haben, oder Nebenwirkungen von Medikamenten, die medizinisch eigentlich gar nicht da sind. Es gibt inzwischen einige Studien, die den Effekt nachweisen können.
Der Nocebo-Effekt: Eine Verschlechterung ohne erkennbaren Grund
"Zum Beispiel wurde asthmakranken Patienten ein Medikament verabreicht, das bestimmte Atemwege in den Lungen verengt", erklären Dr. Michael Bernstein, Dr. Charlotte Blease, Dr. Cosima Locher und Dr. Walter Brown in ihrem Buch "The Nocebo Effect: When Words Make You Sick" (auf Deutsch: "Der Nocebo-Effekt: Wenn Worte dich krank machen"). "Den Patienten wurde allerdings gesagt, dass die Behandlung, die sie erhalten hatten, ein Atemwegserweiterer war. Die Patienten zeigten daraufhin eine Erweiterung der Atemwege." Das Gegenteil konnte ebenfalls beobachtet werden: "Patienten mit Asthma zeigten eine Verengung der Atemwege, wenn der ihnen verabreichte Atemwegserweiterer als Atemwegsverenger beschrieben wurde."
Die Autor:innen beschreiben in ihrem Buch ebenfalls, wie der Nocebo-Effekt bei Parkinson-Erkrankten zu sehen ist: Betroffene der Krankheit leiden häufig an stark verlangsamten Reflexen und Bewegungen. Ein Neurostimulator, der elektrische Impulse sendet, kann hier helfen. "In einer Studie wurde Parkinson-Patienten fälschlicherweise mitgeteilt, dass das Hirnstimulationsgerät ausgeschaltet sei, obwohl es tatsächlich eingeschaltet war." Die Patienten, denen dies gesagt wurde, zeigten tatsächlich verlangsamte Reflexe und Bewegungen, als ob die Stimulation tatsächlich ausgeschaltet gewesen wäre.
Stärkere Nebenwirkungen durch den Nocebo-Effekt
Aber auch außerhalb eines solchen komplexen klinischen Umfelds kann der Nocebo-Effekt sich bemerkbar machen. So können etwa Menschen, die glauben, einer schädlichen Substanz ausgesetzt gewesen zu sein, plötzlich Symptome spüren – auch wenn sie in Wahrheit gar nicht damit in Berührung gekommen sind. Auch bei Impfungen kann es passieren, dass Personen sich einbilden, starke Reaktionen und Nebenwirkungen zu spüren, obwohl diese medizinisch gesehen gar nicht stattfinden.
Es kann also schon reichen, dass eine Ärztin uns vor den Nebenwirkungen eines Medikaments warnt, damit wir diese bekommen. Wir verspüren dann Kopfschmerzen, Übelkeit und andere mögliche Symptome, obwohl wir die Arznei eigentlich gut vertragen.
Unsere Angst ist schuld
Aber was steckt dahinter? Wie kann es sein, dass es uns physisch schlechter geht, obwohl es dafür organisch gesehen gar keinen Grund gibt? Laut Bernstein, Blease, Locher und Brown steckt ein Hormon dahinter, das sogenannte Cholecystokinin (CKK). Das fördere nämlich Angstgefühle im Gehirn und spiele ebenfalls eine Rolle in der Temperaturregulierung. Bei Menschen, die am Nocebo-Effekt leiden, werde mehr CKK ausgeschüttet. Kurzum: Ein Effekt tritt ein, weil wir davor Angst haben.
Aber auch Konditionierungen, soziales Lernen und Erwartungen spielen auf psychologischer Ebene eine Rolle und können dafür sorgen, dass wir Symptome spüren, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Vielleicht haben wir als Kind bei unserer Mutter mitbekommen, dass sie sich nach dem Verzehr eines bestimmten Lebensmittels immer schlecht gefühlt hat – und nun geht es uns nach dem Essen desselben Nahrungsmittels genauso, obwohl wir es in Wahrheit gut vertragen.
Fazit
Eine positive Erwartung kann dafür sorgen, dass ein Medikament wirkt, obwohl es gar keinen Wirkstoff enthält. Ebenso können wir aber auch Nebenwirkungen oder Symptome spüren, obwohl es dafür gar keine organische Ursache gibt. Dabei spielt das Hormon CKK eine Rolle, aber auch psychologische Vorgänge wie Angst und die Erwartung, dass eine bestimmte Wirkung eintritt.
Der Nocebo-Effekt ist also ein weiterer eindrücklicher Beweis dafür, wie groß die Macht unserer Gedanken ist. Ein guter Reminder, darauf zu achten, die Angst nicht gewinnen zu lassen und uns in Optimismus zu üben. Denn ansonsten könnten wir unwissentlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Befürchtete tatsächlich eintritt.
Verwendete Quellen: "The Nocebo Effect: When Words Make You Sick" von Dr. Michael Bernstein, Dr. Charlotte Blease, Dr. Cosima Locher und Dr. Walter Brown, mindbodygreen.com