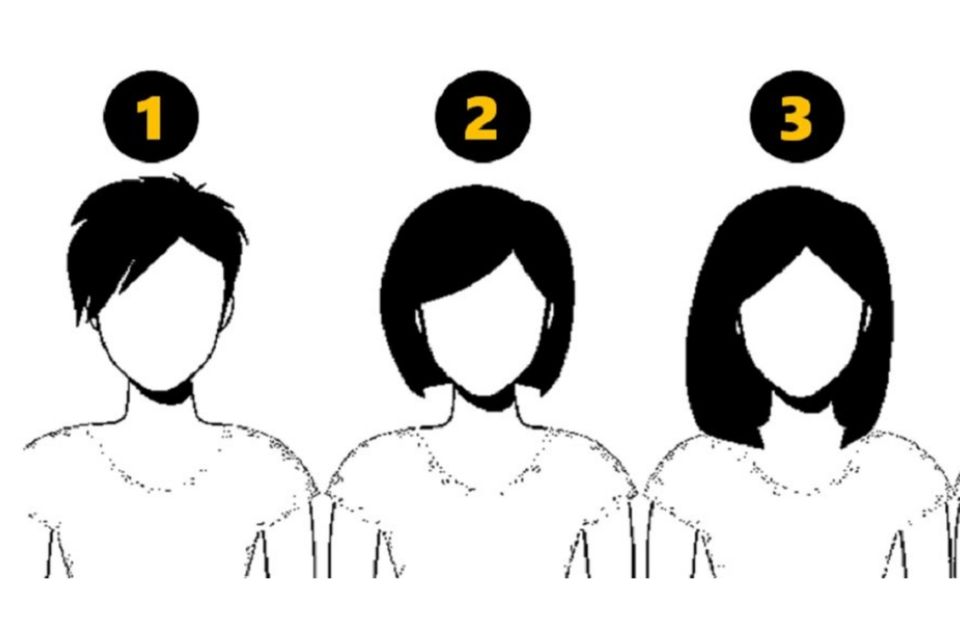Zunächst einmal eine gute Nachricht: Wir brauchen grundsätzlich keine übermäßig große Angst davor zu haben, vermeintlich falsche oder schlechte oder unkluge Entscheidungen zu treffen. Kaum eine unserer Entscheidungen wird katastrophale, permanente oder für uns nicht zu bewältigende Konsequenzen haben – sofern sie uns nicht das Leben kostet. Gewiss können wir hier und da etwas entscheiden, das unser Leben ungemütlich macht. Das uns Ärger bereitet, uns etwas abverlangt, was wir uns lieber gespart hätten, durch das wir etwas verlieren. Aber damit kommen wir klar.
Schwere Zeiten sind ein unvermeidbarer Bestandteil unseres vergleichsweise langen Lebens. Und dass wir die eine oder andere davon selbst durch eine Entscheidung verantworten dürfen, ist im Grunde ein Privileg: Weil es zeigt, dass wir zumindest über einen gewissen Grad an Freiheit und Mitbestimmungsmöglichkeit verfügen.
Allerdings gibt es bei Entscheidungen einige typische Fallen, die uns daran hindern können, mit der uns größtmöglichen Freiheit und Klugheit zu entscheiden. Diese Fallen zu kennen und ihnen auszuweichen, kann uns gegebenenfalls ein paar schmerzhafte Lektionen oder Reuestunden ersparen. Oder uns zumindest in dem Moment der Entscheidung ein stärkeres Gefühl von Kontrolle vermitteln.
4 typische Entscheidungsfehler und wie du sie vermeiden kannst
1. Du entscheidest dich unbewusst für Klarheit.
Die meisten Menschen neigen grundsätzlich dazu, sich eher für etwas Bekanntes zu entscheiden als für etwas Unbekanntes. Aus evolutionsbiologischer Sicht hat diese Strategie klare Vorteile: In unbekannte Gebiete vorzudringen, barg die Gefahr zu verhungern oder zu erfrieren. Eine unbekannte Frucht zu essen, könnte eine Vergiftung bedeuten. Solange keine dringende Notwendigkeit bestand, das bekannte Lebensumfeld zu verlassen, war es sicherer und klüger, dort zu bleiben. Das mag auch heute noch gelten – allerdings mit Einschränkungen.
In unserer modernen Welt droht uns glücklicherweise nicht an jeder Ecke Lebensgefahr. Vielmehr lädt die Welt geradezu dazu ein, Neues auszuprobieren und zu entdecken. Bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, geht es in der Regel weniger darum, unser Überleben sicherzustellen, als darum, eine möglichst hohe Lebensqualität zu erreichen und möglichst zufrieden zu sein.
Das bedeutet: Wann immer wir vor einer Entscheidung stehen, bei der es darum geht, etwas in unserem Leben zu verändern, kann es sinnvoll sein, unsere Gründe ganz genau zu hinterfragen. Alles beim Alten zu belassen wird in unserem Gehirn stets einen Bonuspunkt haben, weil es bedeutet, dass wir überleben. Wenn das aber alles ist, was gegen die Veränderung, gegen das Ungewisse spricht, verspielen wir die Freiheit und die Chancen, die uns unsere gegenwärtige Welt bietet.
2. Du richtest deine Entscheidung (unbewusst) danach, was anderen gefällt.
Da wir hochgradig soziale Wesen sind, ist es uns praktisch unmöglich, die Meinung oder das Vorbild anderer Menschen aus unseren Entscheidungen herauszuhalten. Macht nichts, müssen wir auch nicht. Richten wir uns jedoch einzig und allein danach, was andere tun oder was anderen gefällt, geben wir damit ein Stück unserer Identität auf. Denn wozu bin ich ausgerechnet ich, wenn ich mich doch nur an anderen orientiere?
Das bedeutet: Gerade bei Entscheidungen, über die sich andere Menschen freuen oder die viele andere genauso treffen wie wir, kann es sich lohnen, genauer hinzuschauen. Ist es Zufall, dass es sich so fügt? Oder haben wir unserer eigenen Persönlichkeit und Stimme weniger Gehör geschenkt als den Stimmen der anderen?
3. Du gibst dir nicht genügend Zeit.
Je schwerer uns eine Entscheidung fällt, umso schneller wollen wir sie meist treffen – wenn etwas offen ist, ertragen wir das nämlich nur schwer. Manchmal kann es allerdings sein, dass wir für eine Entscheidung einfach noch nicht bereit sind. Lassen wir uns dann etwas Zeit, kann entweder etwas geschehen, das uns die Entscheidung erleichtert, oder wir gewinnen durch Prozesse in unserem Unterbewusstsein Klarheit. Vielleicht spielen wir im Schlaf unterschiedliche Optionen durch und erlangen dadurch Erkenntnisse oder einen besseren Zugang zu unseren Gefühlen.
Das bedeutet: Wann immer wir uns selbst zu einer Entscheidung getrieben fühlen, deren Deadline noch gar nicht erreicht ist oder für die es keine Deadline gibt, können wir vielleicht davon profitieren, die Entscheidung bewusst ein bisschen aufzuschieben und ihr möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken.
4. Du verrennst dich in deinem Kopf.
Viele Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn sie eine Entscheidung logisch herleiten und vernünftig verargumentieren können. Doch unser Verstand ist nicht die einzige – und auch nicht immer die beste – Ressource, die wir für eine Entscheidung nutzen können. Unsere Intuition und unsere Gefühle sind ein wertvoller Kompass, insbesondere bei sehr komplexen Entscheidungen. Ebenso kann uns der Austausch mit anderen Menschen bereichern und aus unserem Kopflabyrinth heraushelfen, da er alternative Perspektiven aufzeigt.
Das bedeutet: Insbesondere wenn die Pro-Kontra-Liste eine klare Sprache spricht oder die Fakten eindeutig erscheinen, wir uns aber trotzdem nicht zu dem entsprechenden Entschluss durchringen können, ist es wahrscheinlich angebracht, den Blick von der Liste und den vorliegenden Fakten abzuwenden. Am hilfreichsten ist es in der Regel, mit einer Vertrauensperson über die Angelegenheit zu reden – oft erfahren wir dadurch nämlich nicht nur, wie sie die Sache sieht, sondern nehmen zudem unsere eigenen Gefühle stärker wahr.
Verwendete Quellen: Martin Korte, Hirngeflüster: Wie wir lernen, unser Gedächtnis effektiv zu trainieren