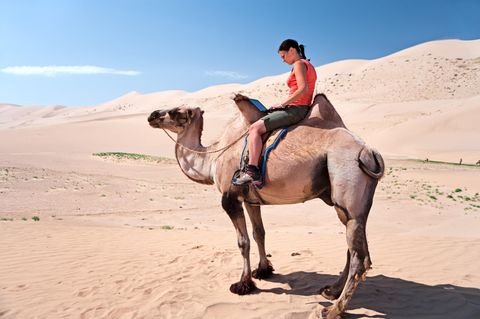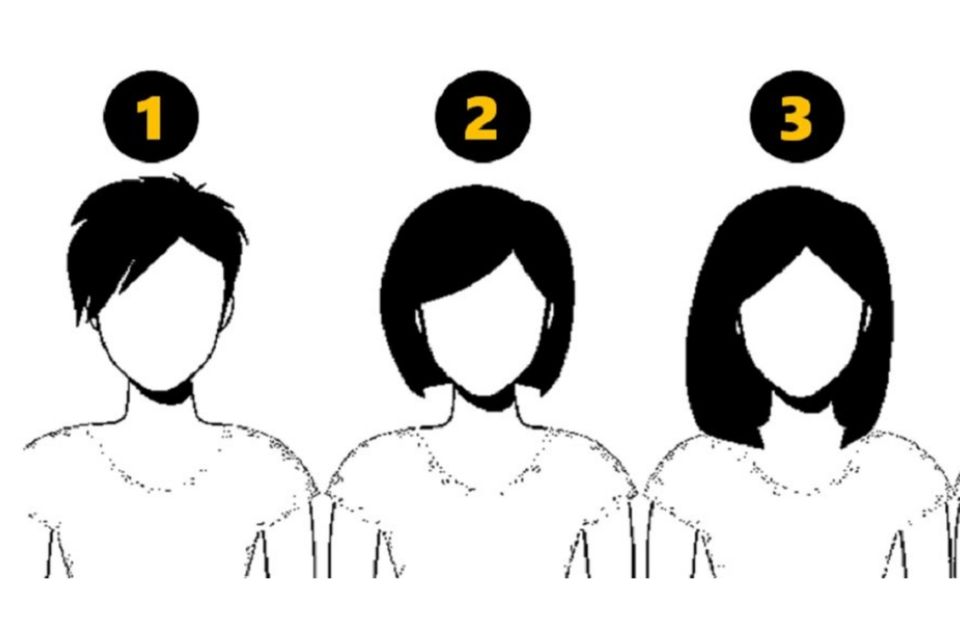Während unsere Freund:innen in der Kindheit und Jugend auf unsere Prio-Liste ganz oben stehen, verschiebt sich der Fokus häufig im Erwachsenenalter. Dass wir eine Freundin oder einen Freund aus den Augen verlieren, ist ein natürlicher Prozess, der häufig mit sich verändernden Lebensstilen zusammenhängt. Also etwa umziehen oder auswandern vs. im Heimatort bleiben, Kinder vs. keine Kinder, starker Fokus auf den Job vs. mehr Freizeit. Denn eins steht fest: Freundschaften müssen gepflegt werden, und das braucht Zeit und gemeinsame Erfahrungen.
Freundschaften haben für Erwachsene oft niedrigere Priorität
Und genau die Zeit fehlt häufig, wenn wir bei Höchstgeschwindigkeit durch die Rushhour des Lebens rasen. Eine jahrelange globale Pandemie mit Kontaktbeschränkungen und Co. hat da sicher nicht geholfen. Das Ergebnis: Viele Freundschaften zerbrechen oder laufen einfach langsam aus – was manchmal nicht weniger schmerzhaft ist als ein dramatisches Zerwürfnis.
Das Problem an der Sache: Im Erwachsenenalter ist es noch dazu sehr viel schwieriger, neue Freundschaften einzugehen. Im Kindergarten, in der Schule und auch im Studium wächst unser Freundeskreis gefühlt täglich an. In (fast) jeder neuen Gruppe, jedem neuen Kurs oder Projekt finden wir Menschen, die wir schnell ins Herz schließen – oder mit denen wir mindestens gemeinsame Interessen haben. Je älter wir werden, desto weniger neue Freund:innen scheinen dazuzukommen.
Im Erwachsenenalter sind die Bedingungen für das Entstehen von Freundschaften erschwert
Warum das so ist, erklärt die US-Psychologin Marisa G. Franco von der University of Maryland gegenüber dem Radiosender "WBUR": "Soziolog:innen haben die Voraussetzungen identifiziert, die wir brauchen, um auf natürlichem Wege Freundschaften zu schließen. Und das sind ständige spontane Interaktionen und eine gemeinsame Verletzlichkeit." Als Erwachsene finden wir uns in solchen Situationen schlicht und einfach immer seltener wieder.
Das Problem liegt also häufig darin, dass wir im Erwachsenenalter erwarten, dass wir genauso selbstverständlich und ständig neue Freund:innen finden wie als Kinder oder Teenies. Früher haben wir oft schon nach ein paar Tagen, an denen wir in Mathe nebeneinander saßen, ganz automatisch eine Freundin gewonnen – während wir heute nach einem gemeinsamen Projekt mit einer lieben Kollegin noch nicht zwangsläufig von einer emotionalen Bindung sprechen würden.
Freund:innen finden als Erwachsene: Nicht auf den Zufall verlassen
Wenn wir also als Erwachsene unseren Freundeskreis erweitern möchten – egal ob wir gerade die Stadt gewechselt haben oder einfach mit alten Freund:innen nicht mehr auf einer Wellenlänge sind –, sollten wir das Ganze strategisch angehen. So unnatürlich sich das auch anhören mag: Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Freundschaften in den Dreißigern, Vierzigern oder auch Sechzigern nicht mehr so einfach aus dem Nichts oder einem zufälligen Teilen desselben Tisches im Klassenraum entstehen. Wir müssen aktiv werden und nicht darauf warten, dass es genauso einfach läuft wie damals.
Also frag doch einfach mal die nette neue Kollegin, ob ihr zusammen Mittag essen oder etwas trinken gehen wollt. Oder deinen Mattennachbarn in der Yogastunde. Der Vorteil bei Kolleg:innen oder Menschen, mit denen wir ein Hobby teilen, ist, dass wir direkt eine Gemeinsamkeit haben.
Eine weitere Option: Frag doch mal deine Freundin, ob sie nicht Lust hat, mit dir und ihrer anderen Freundin, mit der du dich auf ihrem Geburtstag so nett unterhalten hast, etwas zu dritt zu unternehmen. Denn laut der Psychologin Marisa Franco ist es im Erwachsenenalter oft leichter, Bindungen in Gruppen aufrechtzuerhalten und zu pflegen. "Diese Freundschaften sind oft nachhaltiger als solche zwischen einzelnen Personen", erläutert die Expertin. "So gibt es immer mehrere Berührungspunkte. Eine Person aus der Gruppe meldet sich, und so bleiben alle in Kontakt."
Es liegt nicht an dir: Warum wir fälschlicherweise von Ablehnung ausgehen
Aktiv zu werden in der Suche nach Freund:innen hilft dir so nicht nur, das Problem selbst zu lösen – du kannst auch dein vielleicht angeknackstes Selbstbewusstsein aufpolieren. Wenn wir weniger Freund:innen haben und es uns nicht leicht fällt, neue zu finden, suchen wir den Fehler oft in unserer Person: "Mit mir muss ja etwas falsch sein, wenn ich nur wenig Freund:innen habe."
Daran ist absolut nichts dran! Mach dir stattdessen bewusst, dass es oft einfach der Situation geschuldet ist, dass wir als Erwachsene einen kleineren Freundeskreis haben. "Wir alle neigen dazu zu glauben, dass wir öfter abgelehnt werden, als es tatsächlich der Fall ist", sagt die Wissenschaftlerin Marisa Franco zu diesem Phänomen. Du bist nicht allein mit diesem Gefühl.
Und vergiss zu guter Letzt nicht, dass einige innige und tiefe Freundschaften oft viel wertvoller sind als eine große Gruppe aus eher oberflächlichen Bindungen. Wie bei fast allem im Leben gilt letztlich auch hier: Qualität vor Quantität.
Verwendete Quellen: wbur.org, verywellmind.com