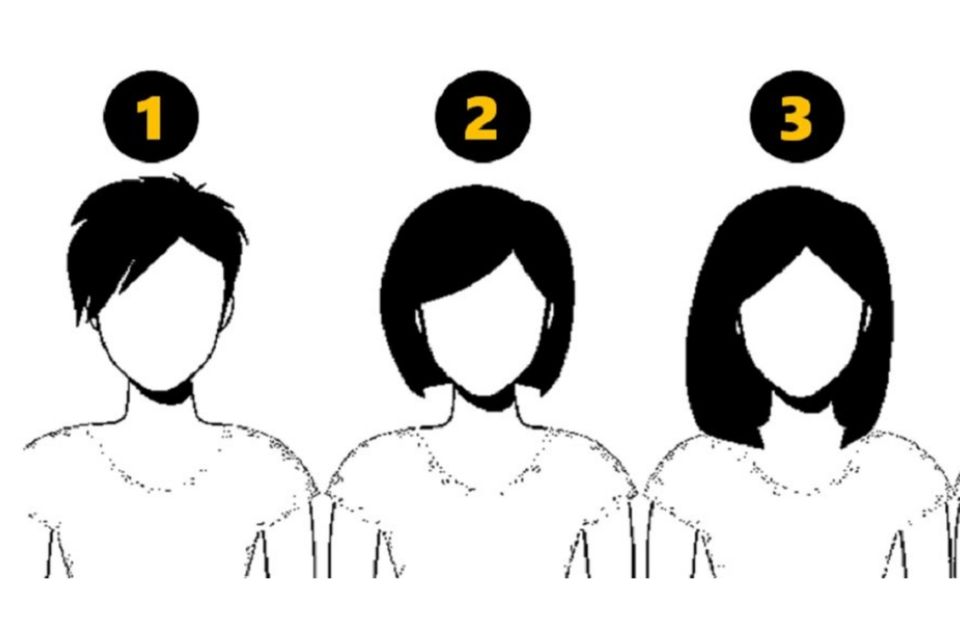Optimistische Menschen sehen die Welt und das, was in ihr geschieht, positiv. Sie besitzen meist ein großes Urvertrauen und gehen grundsätzlich davon aus, dass die Dinge sich zum Guten wenden. Pessimistische Personen dagegen sind oft eher skeptisch und vorsichtig. Sie rechnen häufig mit dem Schlimmsten und haben kein großes Vertrauen darin, dass etwas gut wird.
Um das direkt vorwegzunehmen: Auch wenn Optimist:innen es meist leichter haben und das Leben mehr genießen können, ist erst mal nichts verkehrt daran, eher pessimistisch zu sein. Vor allem deshalb nicht, weil wir uns diese grundsätzliche Denkweise in der Regel nicht so einfach aussuchen können – geschweige denn, sie von heute auf morgen mal eben ändern können. Pessimistisch zu denken, kann ein Bewältigungsmechanismus sein, der tief in uns verankert ist. Menschen, die viel Unsicherheit oder Traumata erlebt haben und deshalb eher ängstlich sind, verwenden Pessimismus häufig unbewusst als eine Art Schutzschild: "Wenn ich mir das Worst-Case-Szenario im Detail ausmale und davon ausgehe, kann mich nichts mehr negativ überraschen."
Ein breites Spektrum: Positive und negative Optimist:innen
Und tatsächlich sind Optimismus und Pessimismus nicht die einzigen beiden möglichen Denkweisen. Vielmehr ist das Ganze ein Spektrum mit vielen subtilen Nuancen. Es gibt beispielsweise positive ebenso wie negative Optimist:innen, wie der Psychologe Dr. Jeremy Sherman auf "Psychology Today" schreibt. Während positive optimistisch denkende Menschen wirklich alles durch die sprichwörtlich rosarot gefärbte Brille sehen, gehen negativ optimistisch denkende Personen zwar hoffnungsvoll an Situationen heran, allerdings mit einem gesunden Maß Realismus.
Dr. Sherman nennt einige Beispiele für solche negativen Optimist:innen: Dazu zählen etwa Onkologinnen oder Kriminologen. Denn beide Berufsgruppen glauben an eine bessere Welt und setzen sich bewusst für sie ein. Die Krebsmediziner glauben daran, dass Menschen gesünder und länger leben können, Kriminologinnen gehen davon aus, dass es eine Gesellschaft mit weniger Verbrechen geben kann. Aber um dieses Ziel zu erreichen, erkennen beide Gruppen, dass es etwas Negatives gibt, gegen das es sich zu kämpfen lohnt – in diesen Fällen Krebszellen und Kriminalität.
Positive Optimist:innen dagegen sieht Dr. Jeremy Sherman vor allem in den Bereichen der Politik oder der Religion beziehungsweise Spiritualität. Vertreter:innen dieser Berufsgruppen werben für eine bessere Welt. "Sie verlieren das Ziel nicht aus den Augen, sei es eine utopische Vision einer idealen Welt oder eine Art Himmel nach dem Tod."
Eine gute Portion Realismus kann helfen
Beide Formen des Optimismus haben ihre Daseinsberechtigung in ihren jeweiligen Bereichen. Während eine Onkologin ihre Arbeit nicht gut machen würde, wenn sie blauäugig davon ausginge, dass Krebszellen sich schon nicht bilden würden, wenn wir nur fest daran glauben, dass wir gesund bleiben, würde ein spiritueller Führer, der nur vor den Gefahren der Welt warnt, seiner Rolle vermutlich auch nicht gerecht.
Und gleichzeitig ist es laut Dr. Sherman wichtig zu verstehen, dass Menschen, die negativ optimistisch denken, es oft besonders schwer haben. Denn ist es gar nicht so einfach, sich das positive Denken zu bewahren, wenn man sich gleichzeitig mit einem realistischen Blick auf Krankheiten oder die Abgründe der menschlichen Psyche beschäftigen muss. Das ist aber eben nötig, damit es weiterhin Hoffnung auf eine bessere Welt geben kann.
Fazit: Wie positiv sollten wir denken?
Positives Denken ist gesund und kann uns in vielen Situationen zu einem leichterem, angenehmeren und womöglich sogar erfolgreicheren Leben verhelfen. Aber in bestimmten Bereichen ist eine gesunde Portion Realismus nicht nur hilfreich, sondern sogar notwendig.
Egal, auf welchem Punkt der Optimismus-Pessimismus-Skala du dich selbst einordnen würdest – daran ist erst einmal nichts falsch, sondern einfach das, was du durch deine Prägungen und Erfahrungen als den sichersten Punkt für dich erlernt hast. Aber sich selbst einmal bewusst zu machen, wie es um die eigene Fähigkeit des positiven Denkens steht, kann helfen. Denn so können wir vielleicht mit wenig Reflexion und innerer Arbeit lernen, die Welt etwas positiver zu sehen – oder etwas realistischer.