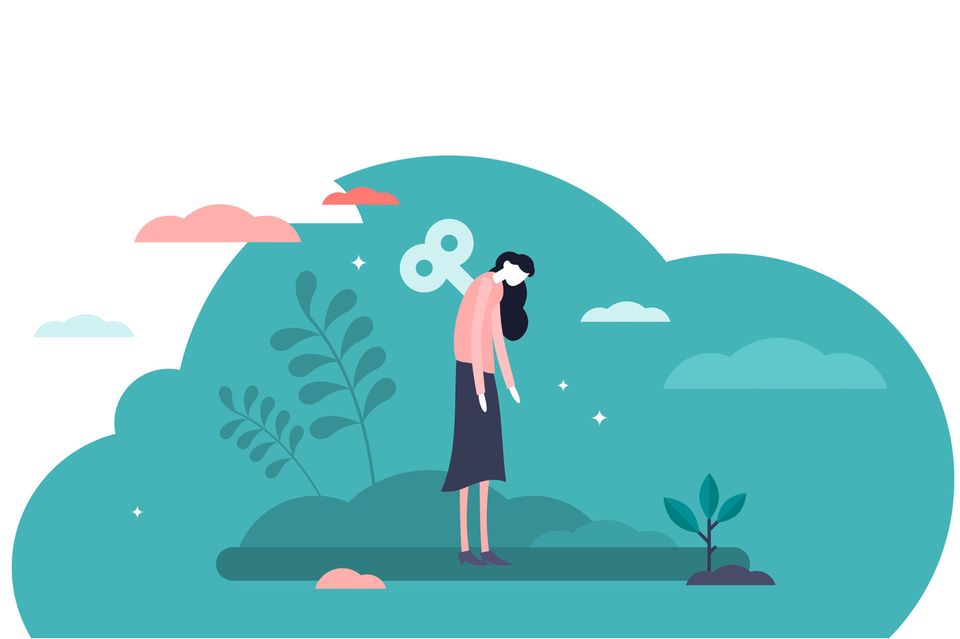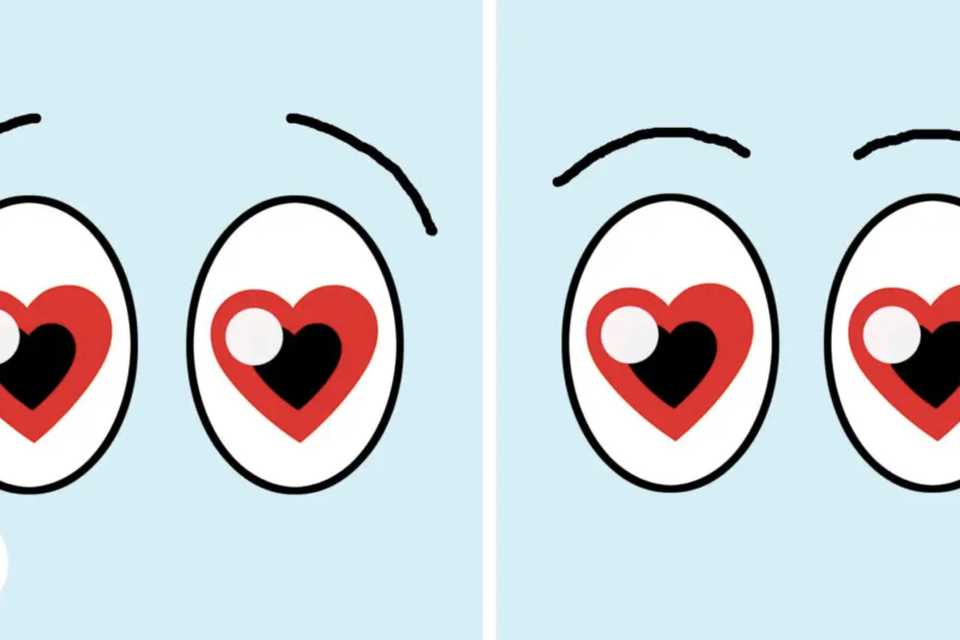Es scheint beinahe unwirklich, wie das Leben von einem Moment auf den anderen in zwei Teile zerfallen kann. Der erste Teil, das ist Rebecca (Susanne Wolff) während ihrer Schwangerschaft: Sie freut sich auf ihr Baby; liebevoll streichelt sie über ihren Bauch, scherzt mit dem Ungeborenen, baut mit ihrem Mann die große Altbauwohnung zu einem gemütlichen Nest um.
Der zweite Teil, das ist Rebecca als Mutter. Alle Fröhlichkeit ist von ihr abgefallen. Unsicher und befremdet beäugt sie ihr Kind, das gesund ist und entzückend und bei allen anderen Menschen in ihrer Umgebung begeisterte "Duziduzi"-Anfälle hervorruft. Nur bei ihr nicht. Statt der bedingungslosen Liebe, die sie wie selbstverständlich erwartet hat, empfindet sie nur Hilflosigkeit und Verzweiflung. Ihr Sohn bleibt ihr fremd. Von Schuldgefühlen überwältigt, erstickt Rebecca beinahe an ihrer Traurigkeit und dem Gedanken daran, eine schlechte Mutter zu sein. Versagt zu haben bei einem Prozess, der doch das natürlichste der Welt sein müsste.
50 bis 80 Prozent aller jungen Mütter kennen die "Heultage" nach der Geburt, die meist drei bis fünf Tage andauern. Die Postpartale Depression (PPD), unter der Rebecca in "Das Fremde in mir" leidet, ist etwas völlig anderes: Sie kann auch lange nach der Entbindung auftreten, noch im zweiten Jahr nach der Geburt. Biologische, psychische und soziale Faktoren wirken dabei zusammen: Der Hormonschub nach der Geburt bringt den Hirnstoffwechsel durcheinander, das begünstigt den Ausbruch der Krankheit; wie auch eine familiäre Vorbelastung, wenn Eltern oder Großeltern unter Depressionen gelitten haben.
Erst bei den Recherchen zu ihrem Spielfilm wurde Regisseurin Emily Atef klar, wie weit verbreitet das Problem wirklich ist. "Immer, wenn ich von meinem Projekt erzählt habe, egal ob auf einer Party oder bei einem Abendessen, kamen Frauen auf mich zu und sagten: 'Ich hatte das auch.'", erzählt die 35-Jährige. "Immer mit gedämpfter Stimme, weil natürlich keine freiwillig aufzeigt und zugibt, dass sie ihr Kind nicht mag." Auch Atef ist in dem Glauben erzogen worden, dass Mütter nach der Geburt sofort eine große Liebe für ihr Baby empfinden, wie ein naturgegebener Instinkt eben. "Es ist doch Wahnsinn, dass Frauen sich immer noch so schämen müssen, darüber zu sprechen, wenn man bedenkt, wie viele an Postpartaler Depression erkranken!"
image
Laut Statistik erleben 10 bis 20 Prozent aller Mütter die schwere Form des Babyblues; verlässlich sind die Zahlen nicht, weil die Krankheit oft gar nicht erkannt wird. Häufig bleiben die Frauen in ihrer Hilflosigkeit allein, viele Ärzte halten sie lediglich für überfordert. Die PPD hat nichts damit zu tun, wie sehr sich eine Frau auf ihr Kind gefreut hat, sie bedeutet auch kein Versagen als Mutter. Genau das werfen sich aber viele Frauen vor; sie spielen ihren Zustand herunter und leiden heimlich. Viele verbieten sich ihre ambivalenten Gefühle: Darf ich denken, dass ich mein brüllendes Kind am liebsten gegen die Wand werfen würde? Oft trifft es gerade Frauen, die einen hohen Anspruch an sich selbst haben, die bisher alles im Leben gemeistert haben und nun völlig hilflos sind. Sie schwanken dann zwischen übergroßer Sorge für ihr Baby und der unerklärlichen Distanz zu ihm.
Der Film zeigt diesen inneren Kampf auf beeindruckende Weise, nur durch Rebeccas verunsichertes Verhalten. Emily Atef wollte zeigen, dass jede Frau betroffen sein kann. Deshalb hat sie Susanne Wolff für die Hauptrolle ausgewählt, eine große, selbstbewusste Frau, kein verhuschtes Mäuschen. Im Film führt sie einen kleinen Blumenladen, steht mit beiden Beinen im Leben und hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter (gespielt von Maren Kroymann). Atef wollte verhindern, dass der Zuschauer es sich leicht macht und sagt: "Ach so, die wurde selbst schon nicht geliebt" oder "Ach so, die wohnt im Plattenbau und wird von ihrem Mann geschlagen, dann ist das ja auch kein Wunder."
Die Postpartale Depression ist keine neue Erkrankung. Sie tritt jetzt nur häufiger zutage, weil es immer weniger Großfamilien gibt, in denen die Frauen aufgefangen und nach der Geburt entlastet werden. Und sie ist kein westliches Phänomen. In Japan ziehen Neu-Mütter nach der Geburt mehrere Wochen lang zu ihren eigenen Müttern, um sich pflegen zu lassen. In Papua-Neuguinea gibt es Mütterhäuser, in denen ihnen für einige Wochen alle Arbeit abgenommen wird. So können sich die Frauen von der Geburt erholen und sich an ihr neues Leben mit Kind gewöhnen.
Nach außen hin versuchen postpartal depressive Mütter, alles richtig zu machen. Betroffene erzählen, wie sie ihr Baby nach jeder Mahlzeit wickelten, selbst in der Nacht, und irgendwann gar nicht mehr einschliefen, weil das Kind sowieso gleich wieder wach werden würde. Gedanken und Gefühle waren wie ausgelöscht, es gab nur noch einen funktionierenden Körper. Das kann nicht lange gut gehen. Und so reichen die Symptome von anhaltender Erschöpfung und Schlaflosigkeit über Angstzustände bis hin zu Selbstmordgedanken.
Dabei sind die Heilungschancen bei einer PPD sehr gut, fast jeder Mutter kann geholfen werden. Oft durch Antidepressiva, etwa die so genannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Die gelten als gut verträglich und machen weder abhängig noch müde. Viele psychiatrische Kliniken bieten ambulante und stationäre Behandlungen für Mutter und Kind an. In Deutschland brauchen fünf von tausend Frauen eine vollstationäre Therapie. Allerdings gibt es nur etwa zwei Dutzend tagesklinische Plätze und rund 140 stationäre - um alle zu versorgen, wären etwa 800 solcher Plätze notwendig.
Eine der bekanntesten Einrichtungen ist das Mutter-Kind-Zentrum in Herten bei Gelsenkirchen. "Wir bemuttern die Mutter, damit sie Mutter sein kann", sagt Luc Turmes, ärztlicher Direktor in Herten. Ziel ist es, den Mutterinstinkt wieder hervorzuholen, der durch die Depression überdeckt wird. "Die betroffenen Frauen haben zwar dieselben Gefühle wie jede andere Mutter auch, nehmen sie aber als bedrohlich wahr." Alles, was nicht erkrankte Mütter intuitiv mit ihrem Baby tun würden, stellen die Patientinnen infrage oder können es nicht abrufen. Die Therapeuten üben mit den Müttern, wieder in Kontakt mit dem Kind zu treten, erklären, dass Babys langsame, fließende Bewegungen lieben, dass sie fest gehalten werden wollen, nicht ängstlich-lasch. Gemeinsam versuchen sie, die Signale des Babys zu deuten. Manchmal umarmen sie auch die Mutter, lang und fest. "Körpergedächtnisspuren wiederfinden", heißt diese Übung.
Eine mehrwöchige Behandlung wie in Herten kostet im Schnitt etwa 2000 Euro mehr als die von den Krankenkassen gezahlten üblichen Pflegesätze. Die Mutter-Kind-Therapie ist teuer, auch die "hohe Pflegepräsenz", wie es offiziell heißt. Viele Kliniken gründen deshalb Fördervereine und sammeln Sponsorengelder, um die Kosten niedrig zu halten.
Eine bundesweite Selbsthilfeorganisation zur Postpartalen Depression und Psychose ist "Schatten und Licht" (www.schatten-und-licht.de). Dort findet man Kontakt zu regionalen Selbsthilfegruppen, telefonische Beratung, Informationen über Früherkennungen und einen Fragebogen, um das eigene Erkrankungsrisiko abzuklären. Mütter von "Schatten und Licht" und eine Psychologin haben auch die Dreharbeiten zu "Das Fremde in mir" begleitet und Emily Atef und ihrer Co-Autorin Esther Bernstorff geholfen, jede Szene auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.
Das merkt man diesem authentischen und nachvollziehbaren Film auch an. Auf den Festivals, auf denen er bereits lief, vor allem in Cannes und München, ließ er das Publikum nicht los. Nach jeder Vorführung gab es lange Diskussionen. Einige Zuschauer erfuhren zum ersten Mal von der Krankheit. Vielen ging aber auch endlich ein Licht auf, erzählt Emily Atef: "Mehrere Männer kamen zu mir und sagten 'Jetzt verstehe ich endlich, wie einsam und hilflos meine Frau war, das habe ich damals gar nicht richtig mitbekommen!'" Die Regisseurin hofft, mit ihrem Film wenigstens einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, die PPD zu enttabuisieren: "Es ist wichtig, einfach mehr darüber zu reden", sagt sie. "Man sollte das Thema Mutterschaft von seinem Heiligenschein befreien und nicht länger erwarten, dass eine Mutter ständig glücklich sein soll. Es wäre für viele Frauen einfacher, wenn sie wüssten, dass sie nicht sofort die perfekten Muttergefühle haben müssen. Und dass das nicht schlimm ist."