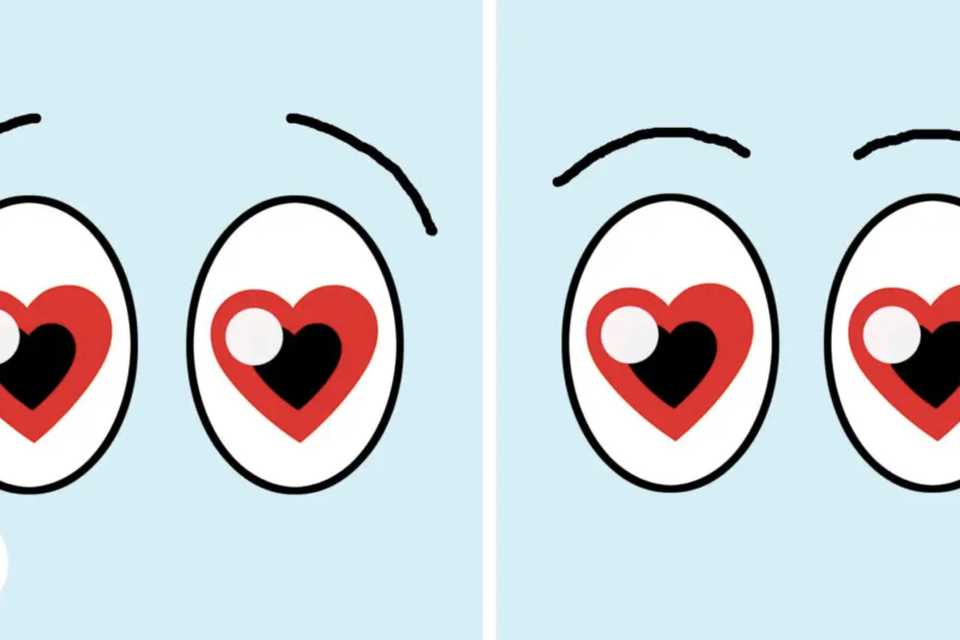Vielleicht ist Mut ein Missverständnis. Mutige gelten als stark. Jene von uns, die ihn missen, eher als schwach. Als gäbe es zwei Sorten von Menschen, welche mit und welche ohne. Als käme man so auf die Welt, wie manche ihre Zunge rollen können, und, Pech gehabt, andere eben nicht. Vielleicht entstand dieses Missverständnis aus der Annahme heraus, Mut sei das Gegenteil von Angst, und wer ihn besitzt, fürchte sich nicht. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Mut ist eher das: Angst zu haben und es dennoch zu tun. Er bedeutet, die Furcht sehr wohl zu spüren und diese Schwelle bewusst zu überschreiten. Zu wagen, zu springen, wo gesprungen werden muss.
Mut ist individuell, wir alle haben eine andere Art, ihn auszudrücken, manche trauen sich mit Walen in der Größe eines Omnibusses im Meer zu schwimmen, aber schaffen es einfach nicht, sich selbstständig zu machen. Erstellen unzählige Businesspläne, legen Excel-Tabellen an und bewegen sich doch keinen Schritt. Im tibetischen Buddhismus hat das Wort Krieger eine andere Bedeutung als bei uns. Das Wort pawu (warrior) heißt wörtlich übersetzt "one who is brave". Menschlicher Mut wird in dieser Tradition hoch angesehen, hat aber nichts mit Fallschirmsprüngen zu tun, sondern damit, keine Angst zu haben, wer du bist. Die Definition von Kühnheit lautet dort: Fürchte dich nicht vor dir selbst. Wenn du weißt, dass du dir vertrauen kannst, vertraust du der Welt auch mehr. Selbst dann, wenn sie aus den Fugen gerät – wie gerade wieder.
Mutausbruch statt German Angst
Deutschland verbindet man weniger mit Courage als mit dem Begriff German Angst, ein Wort, das es sogar ins "Oxford Dictionary" geschafft hat. Schissertum als Persönlichkeitsmerkmal einer ganzen Nation, na gute Nacht Marie.
Die positive Nachricht ist jedoch, dass man Mut lernen kann, unabhängig von Herkunft, Alter und Geschlecht. Die Zeit, in der wir leben, schreit förmlich nach einem Mutausbruch, nach Menschen, die sich trauen, laut zu werden, zu handeln, zu gestalten, was wagen, nicht nur als Individuum, auch als Gesellschaft.
Dieser Meinung ist auch Simone Gerwers, Coach, Wirtschaftswissenschaftlerin, und, wie sie sich selbst nennt, "Mutanstifterin". Sie sagt, man sollte viel öfter einen ordentlichen Mutausbruch haben. In ihrem gleichnamigen Buch beschreibt sie die sieben Quellen, die unseren Mut stärken: Fokus, Vertrauen, Verantwortung, Resilienz, Risikokompetenz, Demut und Joyfear (dazu gleich mehr). "Ich bin überzeugt, dass es darum geht, sein Leben in Selbstverantwortung in die Hand zu nehmen, seiner eigenen Lebensspur zu folgen. Mit Neugier auf das Unbekannte, den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, Scheitern und Verfehlen als normale Möglichkeiten zu betrachten", so Gerwers. Aber wie schaffen wir es, in dieser unsicheren Welt im Vertrauen handeln zu können?
Sicherheit? Das gibt es nicht!
Mut oder der Mangel an Mut ist Haltung, man kann sie sich antrainieren. Wir kommen leer auf die Welt, Eltern und Gesellschaft prägen uns, zeigen uns Gefahren und Begrenzung auf und weisen uns den Weg, was geht und was wir besser bleiben lassen. Wir bekommen spätestens über die Erziehung Glaubenssätze mit auf den Weg, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Gefühle von Gefahr werden in unserem Körper gespeichert. Sei es die Angst vor Hunden, Nähe, Neuanfängen oder die vor der Dunkelheit. Was uns selten beigebracht wird, ist, dass Leben vor allem Lernen ist, eine Praxis, keine Meisterschaft. Praxis bedeutet: machen, ausprobieren, spielerisch. Hinfallen, aufstehen. In unserer Kultur werden wenig Fehler geduldet. Die weitverbreitete Folge dessen ist, zu erstarren, auf größtmögliche Sicherheit zu setzen statt auf Risiko.
Der Haken an der Geschichte ist der: Es gibt sie gar nicht, diese Sicherheit. Wenn man das ein für alle Mal verstanden und verinnerlicht, ja, akzeptiert hat, wird das Schwere leichter. Werden die Aufgaben machbarer, werden wir möglicherweise mutiger. Solange wir aber versuchen, die Welt um uns herum zu arrangieren, zu managen, zu kuratieren und zu kontrollieren, sie scheinbar safe zu machen, umso mehr fürchten wir das Unbekannte, das Unkontrollierbare.
Eine Frage, die man sich in Momenten der Hasenfußigkeit nicht oft genug stellen kann, lautet: Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann? Was wäre das Nächstschlimmere? Und dann …? Immer weiter durchspielen. Etwa bei der Idee, seinen sicheren, aber öden Job zu kündigen, eine Partnerschaft, die zur Zweck-WG geworden ist, zu verlassen.
So werden wir mutiger
Den Mut fördert es auch, sich immer wieder daran zu erinnern, dass Gegensätze zu unserem Dasein auf der Erde gehören; das Gute und das Übel existieren parallel. Die US-amerikanische Mutforscherin Cynthia Pury, Professorin an der Clemson University in South Carolina, sagt, dass mutig handelnde Personen mit dem Ziel der Handlung beschäftigt sind, statt mit der angsteinflößenden Sache. Vielleicht ist das ein hilfreicher Gedanke, weil man mit dieser Haltung auf dem Fahrersitz durch die Aufs und Abs der Tage fährt, das Leben bei den Hörnern packt, das Ziel stets im Visier.
Panik entsteht ja, wenn man sich hilflos fühlt, den Umständen nicht gewachsen. Was aber, wenn man seine Existenz so gestaltet, dass man einfach einkalkuliert, dass Dinge schiefgehen können? Am Ende sterben wir alle. Dann entsteht vielleicht kein Heldentum, aber gesunde Demut. Man selbst, andere und das Schicksal können Fehler machen. Es ist okay. Vor allem, wenn man sich ab und zu daran erinnert, dass es Mut braucht, um glücklich zu sein.
Und wir könnten andere sogar mit unserem Mut anstecken. Wenn wir zu Menschen werden, die Zugang zu ihren Gefühlen haben, die neugierig sind und sich deshalb etwas trauen.
Mut kommt selten allein, immer geht eine Furcht voraus. Sie gehört dazu. Man freut sich total auf etwas, das einem auch Angst macht. Diese Ambivalenz nennt sich "Joyfear", Furchtfreude, sie beschreibt eine Angst, die nicht lähmt, sondern Lust auslöst, uns auszuprobieren. Begeisterungsfähigkeit kann andere anstecken. Es muss auch nicht immer ein großer Mutausbruch werden. Manchmal reicht ein kleiner Satz: Du kannst das, weil, schau, ich habe es auch geschafft.