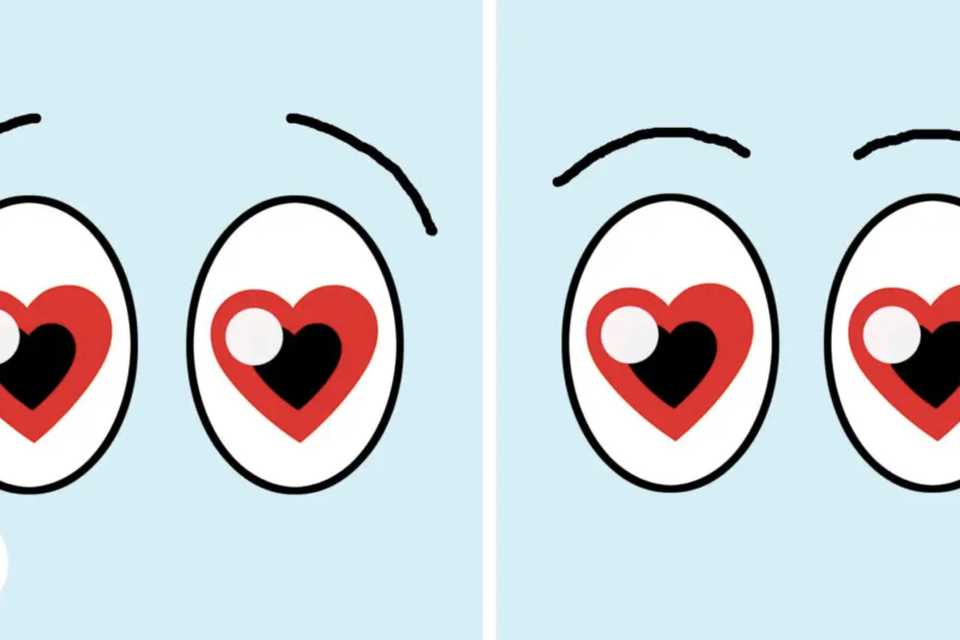*Die kursiv gedruckten Absätze stammen aus Katja Sudings Aufzeichnungen für ihr Buch, das im April bei Herder erscheint.
Es ist Donnerstagnachmittag, Tag zwei einer Doppelsitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Wie schon am Tag zuvor, bin ich auch heute für eine Parlamentsrede eingeplant. Mir geht es überhaupt nicht gut, es geht mir sogar richtig schlecht. Am Morgen hat mich der Wecker aus einem unruhigen Schlaf gerissen. Ich fühle mich wie gerädert und möchte nichts lieber als einfach liegen bleiben und weiterschlafen. Ich möchte mich verstecken, unsichtbar sein, niemanden sehen. Vor mich hinvegetieren und hoffen, dass der nächste Tag Besserung bringt.*
Frau Suding, an diesem Tag im Jahr 2013 – Sie sind seit zwei Jahren FDP-Fraktionsvorsitzende – werden Sie noch einen Heulkrampf auf der Toilette des Rathauses haben. Sie denken darüber nach, wie Sie die Treppe zum Plenarsaal so geschickt hinunterfallen können, dass Sie die Rede nicht halten müssen. Da fragt man sich schon: Warum, um Himmels willen haben Sie sich die Politik überhaupt angetan?
Katja Suding: Darüber habe ich selbst sehr oft nachgedacht. Zum einen war ich schon immer sehr politisch. Ich will mitwirken, dass unsere Gesellschaft ihre Freiheit behält. Jeder Mensch will und kann etwas und das gilt es, zum Beispiel durch ein gutes Bildungssystem, herauszukitzeln und zu unterstützen. Das hat mich immer angetrieben.
Und das zweite Motiv?
Dafür muss ich in meine Kindheit zurückgucken. Als Kind fühlte ich mich nicht immer gesehen und habe versucht, irgendetwas Tolles und Besonderes zu machen, um das zu kompensieren. Das konnte ich auch als Erwachsene nicht ganz abgelegen. Und natürlich ist Politik etwas, wo man gesehen wird. Meinem Inneren aber entsprach das nicht. Vorne stehen, öffentlich sichtbar sein – das liegt mir eigentlich überhaupt nicht. Ich habe dieses kindliche Muster dann später aufgearbeitet.
Sie sind mit 35 als Quereinsteigerin Spitzenkandidatin in Hamburg geworden und haben prompt den Wiedereinstieg der FDP ins Parlament geschafft. Haben Sie anfangs gedacht, Sie wachsen da rein?
Klar. Und dass alle darauf gewartet haben, dass ich scheitere, hat mich total angespornt. Ich habe in der Zeit so viel gearbeitet wie nie zuvor. Und irgendwann weiß man dann auch, wie der Hase läuft. Außerdem habe ich mich an vieles gewöhnt und Routinen entwickelt. Zu Anfang stand ich auf einem Parteitag vor 100 Leuten und wäre fast gestorben, heute ist das kein Problem mehr. Das Paradoxe ist ja auch, dass ich es kann. Ich eigne mich gut für die erste Reihe, auch wenn es mir widerstrebt.
Ich frage mich, wann der Kipppunkt ist, an dem der Preis, den ich bezahle, den Job machen zu können, zu hoch wird. Denn leider ist es so, dass vieles von dem, was für meinen Job gut ist, was meine Währung ist, was mich als Politikerin auszeichnet, mir als Mensch nicht guttut. Es steht in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zueinander.
Wann haben Sie dieses Dilemma das erste Mal bemerkt?
Das ging schnell. Ich war extrem froh, dass es mir gelungen war, einen Schutzpanzer aufzubauen, anders hätte ich die Öffentlichkeit und die Angriffe, übrigens oft auch aus der eigenen Partei, nicht ausgehalten. Aber er hat Menschen auch auf Distanz gehalten. Natürlich sind viele auf mich zugekommen, weil sie etwas wollten, aber das war eine andere Art von Kontakt, als wenn man Menschen wirklich nahekommt.
Und im Privaten?
Wenn ich am Freitag von einer Sitzungswoche gekommen bin, war ich für meine Umwelt kaum zu ertragen. Von morgens bis abends Politik, immer Vollgas, ich war danach so aufgekratzt, dass ich, wenn ich mit Freunden essen gegangen bin, allen auf die Nerven gefallen bin. Ich war erst wieder zu gebrauchen, wenn ich eine Nacht geschlafen und den Samstag zum Runterkommen hatte – und dann ging es am Sonntag oft auch schon wieder nach Berlin.
Meinen Sie, dass es anderen besser gelingt, den Schalter zwischen Politik und Privatleben umzulegen?
Das ist unterschiedlich. Manche brauchen diesen Panzer vermutlich gar nicht. Einige meiner Kollegen lieben die Öffentlichkeit und den Diskurs. Wenn sie angefeindet werden, stachelt sie das eher an. Für sie ist es ein Elixier, während ich denke "Ich will hier raus“.
Ist der Spaß an der Auseinandersetzung eine eher männliche Eigenschaft?
Eher nein, ich glaube nicht, dass das ein Frauen-Männer-Ding ist.
Hätten Sie sich denn trotzdem wohler gefühlt, wenn die deutsche Politik weniger männerdominiert wäre?
Das wäre für alle besser. Diese endlosen Sitzungen, jede Woche Präsidium, Bundesvorstand, Fraktionsvorstand, Landesgruppen, Fraktionssitzung, AGs und AKs – ein Marathon! Und Männer neigen immer noch dazu, sich zu produzieren, etwas zu sagen, nur um etwas gesagt zu haben. Natürlich können das auch Frauen, aber meistens sind es eben doch die Männer. Ich konnte irgendwann nicht mehr ertragen, dass man mir derart die Zeit stiehlt.
Ich laufe weiter, immer schneller. Je unsicherer ich werde, ob ich so weitermachen will, desto mehr strenge ich mich an, desto intensiver suche ich. Aber wonach eigentlich? Ich denke nach, aber ich weiß es nicht. Will ich dieses Leben wirklich führen? Oder ist es nur die Vorstellung von einem Leben, das ich führen sollte? Und woher weiß ich das?
Sie haben Ihre Zweifel lange von sich geschoben. Zu lange?
Nein, das war schon alles richtig so. Es war ja längst nicht alles furchtbar. Natürlich ist es cool, wenn man Wahlen gewinnt. Das hat mich echt gekickt. Die Menschen, die man trifft, die Themen, mit denen man sich beschäftigen darf – das ist toll. Gewählte Abgeordnete zu sein ist eine große Ehre. Der Entschluss "Jetzt steige ich aus“ braucht einfach Zeit und nicht zuletzt auch Selbstvertrauen, dass es danach gut weitergeht. Als ich den Schritt getan hatte, sind aus unterschiedlichen Fraktionen Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben: Würd ich auch gern, aber ich bin noch nicht so weit.
Macht man auch aus Eitelkeit weiter?
Sicher, aber es geht tiefer. Die Flughöhe ist hoch, man ist wer, wird gefahren, gut bezahlt, hat Zugang zu Informationen – das ist dann alles weg. Es geht um Bedeutung, aber teilweise auch um ganz existenzielle Sorgen.
Na ja, auf der Straße landet vermutlich niemand, die oder der im Bundestag saß.
Aber es hat auch nicht jeder danach einen gut bezahlten Lobbyjob. Im Nachhinein war meine Angst vor dem Danach unbegründet – ich hatte eine halbe Stunde nach der Ankündigung, nicht wieder zu kandidieren, die ersten Jobangebote im Mail-Postfach –, aber das weiß man ja vorher nicht. Und dann gibt es auch noch diesen Gedanken: Kann man bei einem Job, für den man so hart gekämpft hat, den so viele andere gern hätten, einfach sagen: Jetzt will ich nicht mehr. Ist das nicht vollkommen arrogant? Auch das musste ich erst mal überwinden.
Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens angekommen und muss mir eingestehen, dass dies nicht einfach nur eine schlechte Phase ist, die vorbeigehen wird. Es funktioniert nicht mehr, den Widerspruch auszuhalten zwischen dem, was ich getrieben durch Muster und Konditionierungen als vermeintliche Ziele verfolge und dem, was ich im Grunde meines Wesens bin. Dadurch ist ein riesiges Loch in mir entstanden, ich bin innerlich ausgehöhlt. Ich fühle mich, als wenn ich das Leben führe, das vielleicht richtig ist für eine andere Person, aber nicht für mich.
Was war dann wirklich der Moment, die Reißleine zu ziehen?
Das war ein Prozess und die Entscheidung an sich am Ende recht unspektakulär. Wir hatten im September 2020 Landesparteitag in Hamburg, danach stand die Listenaufstellung für die Bundestagwahl an. Natürlich erwartete jeder, dass ich wieder antrete. Ich habe mir meine Rede für den Parteitag überlegt und die Message, die ich rüberbringen will. Und dann saß ich mit meinem Freund beim Lunch und ganz plötzlich war mir klar, was ich eigentlich sagen will, nämlich dass ich nicht mehr kandidiere und auch für meine anderen Ämter nicht mehr zur Verfügung stehe.
Wie haben Sie in dem Moment gefühlt?
Wie auf Droge. Ich war so glücklich. Es fühlte sich perfekt und total rund an. Ich habe mich darauf gefreut, diesen Satz dann auch auf dem Parteitag auszusprechen. Danach konnte ich das letzte Jahr noch einmal richtig genießen. Diese Hochstimmung hält bis heute an.
Sie vermissen gar nichts?
Doch. Zum Beispiel mein Team. Das war mein geschützter Raum und wir hatten auch immer viel Spaß. Und manchmal denke ich, es wäre schön, bei den Koalitionsverhandlungen dabei gewesen zu sein – vor vier Jahren habe ich Jamaika ja noch mitverhandelt, auch wenn es dann gescheitert ist. Aber der Gedanke ist dann auch schnell wieder weg. Das Schreiben an meinem Buch macht mir so viel Spaß. Da bin ich schon dankbar, dass ich an schönen Orten sitze und nicht im Parlament.
Und Sie haben keine Angst, noch mal falsch abzubiegen im Leben?
Davor ist man nie gefeit. Aber das Schöne ist ja, dass ich, je älter ich werde, mehr und mehr Bewusstsein dafür entwickele, das dann auch zu erkennen und zu korrigieren. Man vertraut sich mehr und wird mutiger.