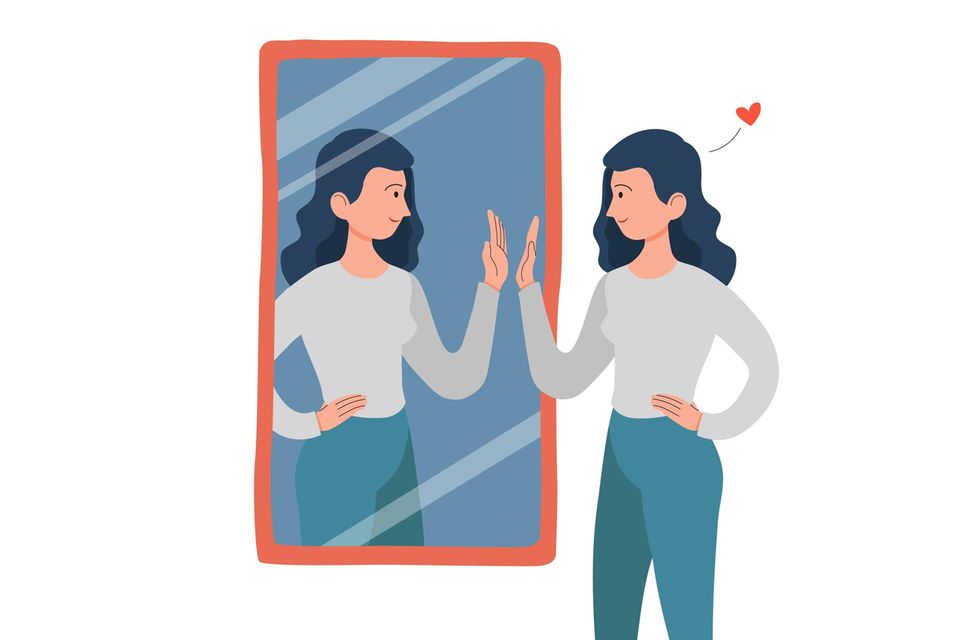Vor einigen Wochen saß ich, noch in die leichte Jacke gehüllt, mit einer Freundin auf Balkonien. Die Sonne zog uns magisch an, fast so, als hätten wir jahrelang keinen Frühling mehr erlebt und nur in der Finsternis gelebt. Wir setzten uns neben einen Rosenbusch, der sein erstes Grün ausrollte, scannten die Zweige nach weiteren Knospen ab, studierten die Blattstruktur – und genossen das alles wie einen extraordinären Wellnesstag. Ein paar kleine, grüne Blättchen, irgendwo im riesigen Universum, rangen uns eine beinahe kindliche Freude ab. Wir giggelten und waren kurz davor, zu singen, obwohl das keine von uns wirklich kann. Die Hälfte Euphorie hätte vielleicht auch gereicht, man hat ja schließlich auch noch Nachbarn. Aber es ging nicht anders: Wir lebten den Moment. Und das war auch gut so.
Später wurde unser Gespräch etwas ernster, und meine Freundin fragte mich, wie ich die letzten zwei Jahre überstanden habe. Sie habe den Eindruck, es ginge mir ganz gut – im Gegensatz zu ihr. Sie fühle sich völlig aufgeräufelt, dünnhäutig und ängstlich und frage sich, wie es wohl weitergehe auf der Welt. Welche Katastrophe als nächste kommen würde nach Pandemie und Ukraine-Krieg. Ich sagte ihr, dass ich sie verstehe. Und wunderte mich selbst ein bisschen über mich und meine relative Glücklichkeit.
Vielleicht lag es einfach daran, dass ich mein persönliches Waterloo rund um 2015 erlebte, als alles auf einmal kam: schwere Krankheit, das Ende einer toxischen Beziehung, schlechte Auftragslage und dann, als Krönung, ein Autounfall, bei dem ich mich in den Sekunden vor dem Aufprall an der Leitplanke innerlich von dieser Welt verabschiedete. Ich war am Tiefpunkt. Ein Wrack.
Langsam bergauf
Von dort, wo ich mich befand, konnte es nur aufwärts gehen. Und es ging aufwärts, in Trippelschritten, mit vielen Einbrüchen zwischendurch. Ich wollte mich einfach nicht unterkriegen lassen. Vor allem aber wollte ich nicht hängen bleiben auf diesem "Ach, mich hat’s so schwer erwischt, warum ist das Leben nur so grausam?". Nichts ist so sinnlos wie Selbstmitleid und diese Frage. Also gab ich mir das ganze Wiederaufsteh-Paket: Yoga, Therapie, Selbstfürsorge- und Achtsamkeitskurs. Es dauerte fünf Jahre, aber dann: stand ich wieder.
Seitdem freue ich mich täglich über jeden Grashalm, der wächst. Bin dankbar, jeden Tag, dass die Talsohle nicht mein Ende war. Und schiebe es nie wieder beiseite, das Argument, dass Dankbarkeit so wichtig ist. Wir werden sie brauchen müssen, um weitermachen zu können, um Kraft zu sammeln und menschlich zu bleiben.
Denn es ist ja nicht so, dass die Welt vor Corona hübsch in Ordnung war. Irgendwas ist immer: Klimakrise, Demokratieverfall, Inflation – und dazu schlägt sich jeder noch mit seinen eigenen, ganz persönlichen Themen herum. Wir sind nervös und dünnhäutig und gehen bei jedem bisschen auf die Palme, analog und digital. Gleichzeitig sind wir im Westen auch immer noch sehr verwöhnt und satt, wächst zeitgeistlich die Ich-Zentrierung, wirtschaftlich die Schere zwischen Arm und Reich. Doch spätestens jetzt, nach zwei anhaltenden Premium-Krisen, haben wir es schwarz auf weiß: Wir mögen unsere eigene, kleine Welt gerade so zusammenhalten können, das Große und Ganze haben wir nicht im Griff. Trotzdem – und das tut gut zu sehen – können wir immer noch Solidarität und Hilfsbereitschaft. Weil Geben eben auch Bekommen ist. Wir fühlen uns einfach besser, wenn wir anderen helfen können. Es lindert unseren eigenen Kummer, ein evolutionäres Gesetz aus Tagen, da wir noch in einer Horde rund ums Feuer saßen und das Überleben nur gemeinsam ging. Doch helfen ist das eine, aber wie selber weiterleben, wenn nebenan der Krieg tobt? Dürfen wir lachen, während andere im Bombenhagel sterben? Dürfen wir tanzen, lieben, reisen, dummes Zeug erzählen? Uns an Dingen festhalten, die uns zerstreuen?
Dunkle Gefühle sollen nicht an erster Stelle stehen
Ja, wir dürfen, und ich bin froh, dass die Antwort darauf so einfach ist, auch wenn es schwerfällt, sie lässig auszusprechen. Das schlechte Gewissen, das sich bei vielen von uns meldet, ist ehrenhaft, im Griff haben sollte es uns jedoch nicht. Denn mordet Putin weniger, wenn wir darüber weinen, dass er mordet? Hört fremdes Leid auf, wenn wir uns selber martern? Lässt sich ein Virus mit Trübsal stoppen? Kollektive Agonie und Endzeitstimmung hilft zu keiner Zeit, was nicht heißen soll, dass alle diese Gefühle nicht berechtigt sind. Doch! Ja! Auf jeden Fall! Sie dürfen, sollen da sein. Doch wenn sie die Führung übernehmen und unseren Blick verdunkeln, schaden wir uns selbst. Stärke und Zuversicht speisen sich nun mal eher aus Positivität. Und die wiederum erwächst aus Dankbarkeit. Aber nicht aus dieser hohlen, aufgesetzten, die inzwischen jede "Germany’s Next Topmodel"-Bewerberin herunterrasselt für all die Demütigungen, die ihr im Trash-Format passieren.
Es geht um echte, lebendige, wirklich empfundene Dankbarkeit. Um Demut. Dafür, dass wir gesund sind, wenn wir es sind. Dafür, dass wir in der Sonne sitzen und Kuchen essen können. Dafür, dass wir alles haben, was wir brauchen, zumindest materiell. Lasst euer Ego ruhen, Leute, das meiste schafft ihr euch nur an, um den Nachbarn zu beeindrucken! Vergleicht euch nicht nach oben, sondern schaut endlich mal nach unten. Da leben die meisten Menschen, weit entfernt von unserer "Schöner Wohnen"-Welt. Was, du hast keinen SUV wie Freundin X, bist nicht so schlank wie Kollegin Y, und Freundin Z fliegt schon wieder auf die Malediven? Alles Gedankenzeugs, das geradewegs ins Unglück führt. Dankbarkeit beginnt bei Dingen, die der modern gehetzte Mensch schlicht nicht mehr wahrnimmt oder die ihm albern, naiv oder zu simpel vorkommen: Wie bitte, ich soll froh sein, dass ich ein Dach über dem Kopf habe? Ist doch normal! Nein, ist es nicht.
Natürlich braucht man Herz und Empathie, um zu verstehen, dass diese Art Dankbarkeit eine Art Goldader ist fürs eigene Seelenleben, dass Wertschätzung für sogenannte Kleinigkeiten großes Wohlgefühl erzeugen kann. Dankbarkeit – das verbrieft die Forschung – erhöht unsere Zufriedenheit mit uns selbst und mit anderen. Sie macht uns hilfsbereit, großzügig, lässiger im guten Sinne. Und kein Aufwand ist vonnöten, praktiziert werden kann Dankbarkeit auf jeder U-Bahnfahrt, auf jeder Yogamatte, selbst beim Gemüseputzen oder Fernsehgucken. "Nicht Glücklichsein führt zur Dankbarkeit, sondern Dankbarkeit zum Glücklichsein", sagt der österreichisch-amerikanische Benediktinermönch David Steindl-Rast, und wer darauf herumdenkt, wird schnell merken: Hört sich zwar an wie ein Kalenderspruch, ist aber schnörkellose Wahrheit.
Glücksmomente sammeln
Auch die Münchener Paar- und Familientherapeutin Annette Frankenberger bringt ihren derzeit verunsicherten Patient:innen bei, die Weltkrisen nicht zu sehr an sich heranzulassen. Nicht ständig Nachrichten zu schauen, Pausen davon zu machen: "Fragen Sie sich, wo Sie gerade sind und wer und was wichtig ist im Moment. Wo können Sie wirksam werden – und wo nicht." Sie plädiert dafür, kleinschrittig Glücksmomente einzusammeln, um der Angst, den Sorgen etwas entgegenzusetzen. Ein Gang mit dem Hund, ein Spaziergang im Park. "Manchmal hilft es auch, die Dinge aufzuschreiben, eine Art Tagebuch zu führen", sagt Frankenberger. Man kann beispielsweise in Kategorien auflisten, was einem am Tag so beschäftigt hat: "Es ist blöd, dass …" und "Es ist gut, dass …" In ihrem Podcast "15 Minuten fürs Glück" setzt sie sich mit all diesen Fragen auseinander, die Menschen Halt geben können in einer Welt außer Rand und Band.
Auch international finden sich dieser Tage überall Menschen, die sich – wie man selbst – fragen, wie man Anteilnahme für das Weltgeschehen und Selbstfürsorge gut vereinbaren kann. Der australischen Autorin Brooke McAlary, deren Ratgeber zum einfacheren, bewussteren Leben Bestseller geworden sind, ging es seit 2020 und mit dem Ausbruch von Corona oft so schlecht, dass sie nicht mehr aus dem Bett kam. Aber schnell begriff sie, dass sie der "großen Sorge" ums Ganze, dem "Big Care", nicht gerecht werden kann. Sie konzentrierte sich auf "Small Care" und begeistert seitdem mit ihren Überlegungen in ihrem Podcast und einem neuen Buch ("Care: Was wir gewinnen, wenn wir uns Zeit lassen", Verlag Lübbe Life) ein Millionenpublikum. Das hört sich dann so an: "Wenn Sie morgens aufwachen, nehmen Sie sich dreißig Sekunden Zeit, um einfach ruhig dazuliegen und den Geräuschen zu lauschen. Steigen Sie eine Haltestelle früher aus als sonst! Stellen Sie die Möbel im Schlafzimmer um!" Aber es hört sich auch so an: "Wir alle träumen von einem magischen Rosengarten hinter dem Horizont, anstatt uns an den Rosen zu erfreuen, die direkt vor unserem Fenster blühen."