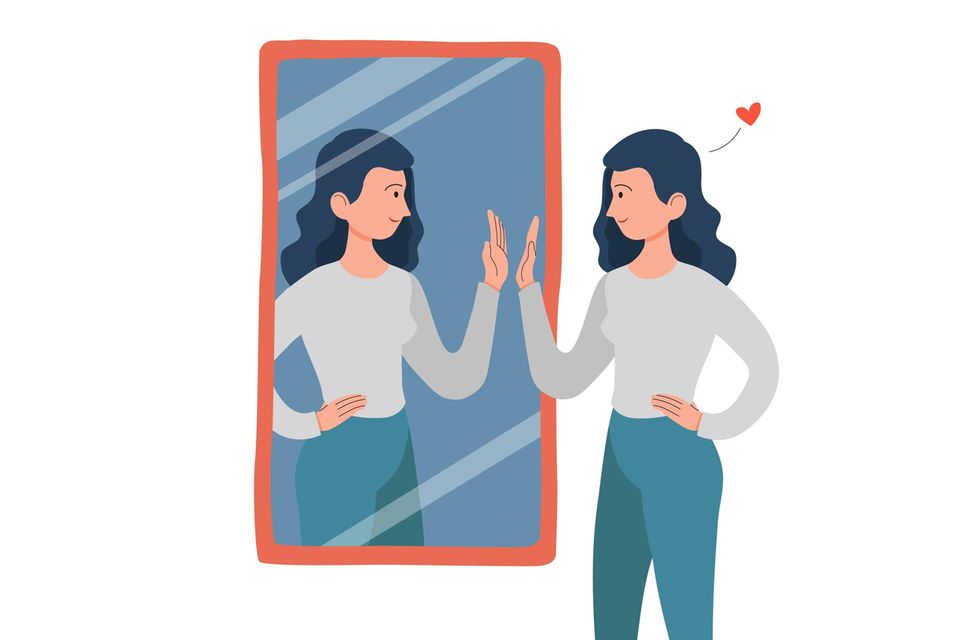Vor Kurzem lernte ich auf einer Party eine Frau kennen. Nina ist Anfang dreißig, lebt in Berlin, hat längere Beine als Marlene Dietrich,ein ansteckenderes Lachen als Liselotte Pulver, und als ich dann noch erfuhr, dass sie Bezirksmeisterin in Karate war und gerade an einer Reportage über "moderne Piraten" schrieb, war ich endgültig beeindruckt. Wir verabredeten uns für die folgende Woche auf einen Kaffee, und ich dachte: "Wow, endlich mal eine entspannte, souveräne Frau."
Als ich Nina im Café traf, war ich wieder beeindruckt. Sie erzählte von ihrer Reise durch Indonesien, Sumatra, Malaysia, die sie im letzten Sommer(allein)unternommen hatte und bei der ihr die Idee zu der Reportage gekommen war. Vielleicht enthielte die Geschichte sogar genügend Stoff für ein Buch.
image
Irgendwann später - wir waren vom Kaffee bereits auf Gin Tonic umgestiegen - erklärte sie, dass das mit dem Beruf doch alles nicht so wichtig sei. Im Übrigen sei ohnehin völlig unklar, ob sie die Reportage, geschweige denn das Buch, jemals unterbringen würde. Außerdem hänge ihr die ganze Schreiberei zum Hals heraus. Im Grunde sei sie nur deshalb beim Journalismus gelandet, weil ihr damaliger Freund auch geschrieben habe und sie das Gefühl gehabt habe, sie müsse "ihm das Wasser reichen". Wenn sie ehrlich wäre, würde sie viel lieber etwas ganz anderes machen: Yoga- Lehrerin zum Beispiel. Oder einen Weinladen eröffnen. Berlin könne sie auch nicht mehr ertragen - andererseits sei sie in den letzten zehn Jahren elfmal umgezogen, und die ewige Umzieherei hänge ihr noch mehr zum Hals heraus als die Schreiberei.
Die Wahrheit sei, dass sie endlich einen richtigen Mann kennen lernen wolle und nicht immer nur solche "Hallöchens", mit denen man ein paar Wochen Spaß haben könne, die aber niemals für "was Ernsthaftes" in Frage kämen. Das sei nämlich die "Wahrheit zwei": Sie wolle Kinder, und es kotze sie an, wie unzuverlässig die Kerle seien. Aber vielleicht liege es ja auch an ihr, sie selbst sei schließlich unfähig, sich ernsthaft zu binden - sie bringe es nicht mal fertig, eine Zimmerpflanze so zu gießen, dass sie nicht nach einem Monat die Flügel hängen ließe. Inzwischen sei sie so weit, dass sie ihre Schwester, die in einer süddeutschen Kleinstadt lebt, seit zehn Jahren verheiratet ist, in der Arztpraxis ihres Mannes mithilft und sich ansonsten einfach nur um ihre drei Kinder und den Garten kümmert - dass sie diese Schwester, die sie früher stets verachtet habe, nun um ihr Leben beneiden würde.
Auf dem Heimweg war ich einigermaßen ratlos. Nicht, weil mir diese Anwandlungen, das Gefühl, im Vorspiel zum eigentlichen Leben stecken geblieben zu sein, gänzlich fremd wären. Auch ich habe zwischen verschiedensten Jobs, Wohnungen, Beziehungen gelebt, als sei das Leben ein Cabrio, das man nach misslungener Testfahrt wieder beim Autohändler zurückgibt, um es beim nächsten Mal lieber mit einem Geländewagen zu versuchen. Allerdings liegt diese Lebensphase hinter mir. Und ich bin froh, dass ich keine Energie mehr darauf verschwenden muss, mir auszumalen, was ich alles tun werde, "wenn ich mal groß bin", sondern dass ich meine ganze Kraft in die Gestaltung jenes Lebens stecken kann, das ich tatsächlich führe: mit dem Beruf, den ich liebe, mit dem Mann, den ich liebe, in der Stadt, in der ich heimisch geworden bin.
Habe ich einfach nur Glück gehabt? Oder gibt es einen Grund, warum ich mich mit Ende dreißig in meinem Leben angekommen fühle? Und das, obwohl mir alle Attribute der klassischen, "bürgerlichen" Arriviertheit fehlen: Weder bin ich verheiratet, noch habe ich Kinder oder ein Eigenheim - während Nina von dem Gefühl gehetzt wird, sich in der Warteschleife zu ihrem eigentlichen Leben verheddert zu haben.
Anfang der 80er Jahre veröffentlichte die amerikanische Psychotherapeutin Colette Dowling ein Buch, in dem sie analysiert, warum so viele scheinbar emanzipierte, beruflich durchaus erfolgreiche Frauen mit ihrem Leben unzufrieden sind - unabhängig davon, ob sie in Beziehungen leben oder nicht und ob sie Kinder haben oder nicht. Es heißt "Der Cinderella- Komplex", und die Autorin kommt zu dem ernüchternden Ergebnis: "Im tiefsten Inneren will ich nicht selbst für mich sorgen. Ich möchte, dass es jemand anders tut." Gerade jüngere Frauen verdrehen allerdings genervt die Augen, wenn man den Verdacht äußert, dass sie, 25 Jahre später, immer noch an diesem "Cinderella-Komplex" leiden.
Ich bin sicher: Auch ich hätte in meinen Zwanzigern angefangen loszufauchen, hätte mir jemand unterstellt, auf dem Grunde meines rebellisch spätpubertären Herzens ein Aschenputtel zu sein. Als ich das Buch vor einigen Jahren las, musste ich jedoch an meine eigenen ziemlich missratenen Beziehungsversuche der damaligen Zeit denken. Nach allem, was ich heute weiß, bin ich wohl tatsächlich nicht auf der Suche nach einem "Beschützer" im klassischen Sinne gewesen - aber hatte ich von meinen "Partnern" nicht insgeheim erwartet, dass sie mich mit mir versöhnten? Dass sie mir endlich zeigten, was alles in mir steckt? Wer ich wirklich bin?
Bei den Gesprächen, die ich 2006 zu meinem Interviewband "Die neue F-Klasse" geführt habe, war ich überrascht, als Sarah Wiener, die erfolgreiche Köchin und Unternehmerin, die gewiss nicht im Verdacht steht, ein Aschenputtel zu sein, unverblümt zugab: "Obwohl meine Mutter zu mir [. . .] immer gesagt hat: 'Heirate bloß nie!', habe ich meine Internatszeit im Wesentlichen damit zugebracht, von dem tollen Typen zu träumen, der eines Tages kommen und mich auf seinen starken Händen endlich in mein Leben hineintragen wird [. . .] Als Jugendliche dachte ich nur: Ich kann nichts und bin nichts. Gleichzeitig hatte ich tief in mir drin das Gefühl: Aber eigentlich bin ich ja etwas ganz Besonderes und Tolles. Vielleicht war ich so eine Art Froschkönigin. Ich dachte, wenn der Prinz auf dem weißen Schimmel angeritten kommt und mich küsst, dann bricht mein Lebensglück, dann brechen Glanz und Gloria endlich hervor."
Auf meine Nachfrage, ob es denn so gekommen sei, antwortete Sarah Wiener lachend: "Ich muss meinen beiden Ehemännern wirklich dafür danken, dass sie keine Mr. Rights waren. Wer weiß, wenn sie zuverlässiger, 'perfekter' gewesen wären, hätte ich vielleicht noch viel länger gebraucht, um zu erkennen, was eigentlich jedes Horoskop- Abziehsprüchlein weiß: 'Dein wahres Glück, liebe Sarah, das liegt nur in dir selbst.'"
An diese Selbsterkenntnis und an Ninas Unglück musste ich denken, als mir vor wenigen Wochen das Buch "Neue deutsche Mädchen" von Jana Hensel, Jahrgang 1976, und Elisabeth Raether, Jahrgang 1979, in die Hände fiel. Anfangs ärgerte ich mich über den Titel, weil ich es für den einen albernen Verlagseinfall hielt, ein Buch über dreißigjährige Frauen "Neue deutsche Mädchen" zu nennen. Doch im Laufe der Lektüre wurde mir klar, dass der Titel keinem reinen Marketing-Kalkül entsprungen war, sondern dass die Autorinnen sich tatsächlich eher als unbehauste, suchende "Mädchen" denn als gestandene Frauen begriffen.
So schreibt etwa Elisabeth Raether: "Ich blieb in keiner meiner Berliner Wohnungen länger als ein Jahr. [. . .] Deshalb machte ich mir gar nicht erst die Mühe, mich einzurichten. Von den Zimmerdecken hingen Glühbirnen, statt Bilder aufzuhängen, klebte ich mit Tesafilm Postkarten an die Wand; meine Bücher stapelte ich auf dem Boden. [. . .] Ich war nicht die Einzige, die so lebte. In einer Wohnung, in der ich einmal eine Nacht verbracht habe, lehnte im Schlafzimmer gegenüber vom Bett ein Mountainbike an der Wand, so dass ich den Eindruck bekommen konnte, ich säße in einem Straßencafé. Es gab keine Vorhänge, und stattdessen waren Bettlaken über den Fensterrahmen geworfen worden. Dort, wo andere im Bad einen Spiegel anbrachten, ragten Kabel aus einem Loch in den Kacheln." Nun muss ein minimalistischer Hausstand ja nicht automatisch der Ausweis einer inneren Leere und Haltlosigkeit sein. Auch ich habe in meinen Studienjahren im Wesentlichen aus zwei Koffern gelebt, zeitweise sogar auf einer Luftmatratze geschlafen.
Manche meiner Freunde leben immer noch mit so leichtem Gepäck, dass sie morgen problemlos nach Amerika auswandern könnten. Andererseits habe ich höchstes Verständnis, wenn einem dieses Leben aus der Kiste irgendwann auf den Nerv geht. Ich selbst habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal eine Schrankwand gekauft.
image
Stutzig wurde ich jedoch, als ich las, wovon die junge Frau in ihrer kargen Wohnung träumte: "Ich sehnte mich nach alten Formen, nach richtigen Möbeln, nach schweren Lampenschirmen, nach Bilderrahmen, die an die Wand gedübelt werden, nach Ordnung und Vorhersehbarkeit, nach Verlässlichkeit." Vom ästhetisch Fragwürdigen einer solchen Einrichtung ganz abgesehen - werden hier nicht Ursache und Wirkung verkehrt? Meine Schrankwand habe ich mir zu einem Zeitpunkt gekauft, an dem ich das Gefühl hatte: Ja, ich bin in meinem Leben in einer Weise angekommen, dass ich mir nicht mehr alle Flucht- und Hintertüren offen halten muss. Aber nie hätte ich von einer Schrankwand erhofft, dass sie Ruhe und Stabilität in mein Leben bringen könne.
Den Verdacht, dass die "schweren Lampenschirme" im Grunde nur ein Platzhalter für den Mann sind, der endlich "Ordnung, Vorhersehbarkeit, Verlässlichkeit" in ihr Leben bringen soll, formuliert Elisabeth Raether selbst: "Ich hätte es nie zugegeben, aber ich habe geglaubt, die Liebe würde mich von jeder Sorge befreien und jeden emotionalen Konflikt für mich lösen."
Da begegnet es uns also wieder, das "Großstadt-Aschenputtel", das auf hohen Absätzen scheinbar souverän durchs Nachtleben stöckelt - und sich in Wahrheit doch nach der großen Liebe sehnt, die seinem Leben endlich Halt und Verbindlichkeit schenkt. Nun ist es auch in früheren Zeiten nicht einfach gewesen, einen "Märchenprinzen" zu finden. Doch heute scheint es so schwer geworden zu sein wie noch nie.
Nur wenige Jahre, nachdem Colette Dowling ihren "Cinderella-Komplex" veröffentlicht hatte, diagnostizierte der amerikanische Familientherapeut Dan Kiley bei den Männern der westlichen Wohlstandgesellschaften ein entsprechendes "Peter-Pan-Syndrom": die Weigerung, erwachsen zu werden und im Leben Verantwortung zu übernehmen.
Dass auch Kileys Beobachtungen zwanzig Jahre später nichts von ihrer Aktualität verloren haben, wird klar, wenn man das Buch "Schöne junge Welt - warum wir nicht mehr älter werden" von Claudius Seidl liest. Darin beschreibt der Journalist, Jahrgang 1959, die Männer seiner Generation als verschärfte Peter Pans, die nicht im Traum daran denken, in die Rolle des gesetzten Familienvaters zu schlüpfen, sondern trotz beginnender Geheimratsecken ihre Anzüge immer noch ohne Krawatten, ihre Schuhe immer noch ohne Socken tragen und nächtelang auf angesagten Partys mit "Frauen, wunderbaren Frauen" abhängen. Das Verbindlichste, das eine Frau auf der Suche nach einem stabileren Leben - zu dem möglicherweise auch Kinder gehören sollen - diesem Typus Mann entlocken kann, ist ein "vielleicht später".
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie immer noch in ihren kargen Wohnungen und warten, verschieben, warten . . . So enden die modernen Großstadt-Märchen, in denen Aschenputtel auf Peter Pan trifft.
Und als sei die Lage damit nicht kompliziert genug - in Wahrheit ist sie noch komplizierter: Denn selbst wenn Aschenputtel ausnahmsweise mal einen Prinzen trifft, muss es feststellen, dass es dieses Leben auch nicht wirklich glücklich macht.
Während eines längeren Arbeitsaufenthaltes in Paris lernt Elisabeth Raether Alain kennen, einen 30 Jahre älteren Mann. Der erfolgreiche Anwalt hat sich zwar gerade von Frau und Kind getrennt, dafür weiß er, was sich einer jungen Geliebten gegenüber gehört, nämlich sie immer dann anzurufen, wenn er versprochen hat anzurufen, ihr eine Kreditkarte mit hohem Verfügungsrahmen auszuhändigen und sie in Restaurants auszuführen, in denen es noch die Einrichtung der "Damenspeisekarte" gibt, einer Speisekarte also, die der Dame am Tisch gereicht wird und auf der keine Preise vermerkt sind. Eine Weile fühlt sich die Autorin geborgen, hat zum ersten Mal im Leben den Eindruck, das Rastlose ihrer Existenz abgestreift zu haben. Doch nach und nach setzt das Gefühl ein, dass dieses Leben auch nicht alles gewesen sein kann. Dass die Geborgenheit, die sie zu verspüren meint, schal wird. Dass die Autorin als junge, gut ausgebildete, ehrgeizige Frau der Anforderung, einen Weg für sich selbst finden zu müssen, nicht ausweichen kann
In dem Lied "So viel Leben" der jungen Berliner Band Mathilda heißt es halb ironisch, halb resigniert: "Was fang ich mit so viel Freiheit an? Da brauch ich ja einen, der frei sein kann, einen, der weiß, wie's geht."
In keiner anderen Gesellschaft, zu keiner anderen Zeit haben die Frauen so viele Freiheiten gehabt wie die heutigen Frauen in den westlichen Gesellschaften: Wir sind frei, den Lebenspartner zu wählen, den Beruf, den Wohnort. Wir sind frei, uns für oder gegen Kinder zu entscheiden. Allesamt Freiheiten, die von unseren Vorgängerinnen mühsam erfochten wurden. Und von denen die Frauen in der arabischen Welt, in Bangladesch, in weiten Teilen Afrikas oder Lateinamerikas immer noch träumen müssen.
image
Warum tun sich viele von uns dann so schwer damit, diese Freiheiten beherzt zu ergreifen, sondern fühlen sich von diesen Freiheiten stattdessen gelähmt? In Freiheit zu leben bedeutet, Entscheidungen treffen zu müssen. Und zwar nicht nur die, ob ich mir lieber eine grüne, eine gelbe oder gar keine Handtasche kaufe, sondern vor allem bedeutet es, fundamentale biografische Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung ist aber von der Angst begleitet, es könnte die falsche gewesen sein. Und in der Tat: Niemand garantiert uns, dass wir richtig liegen.
Nun scheint das Problem von Frauen wie Nina oder Elisabeth Raether nicht zu sein, dass sie zu wenig ausprobiert hätten. Im Gegenteil: Es ist sprichwörtliches Kennzeichen der "Generation Praktikum", dass sie höchst mobil ist, vielseitig ausgebildet, in alle möglichen Berufsfelder hineingeschnuppert hat und auch auf dem Feld der Beziehung wenig unversucht gelassen hat. Allerdings scheint bei ihnen dieses Ausprobieren nicht dazu geführt zu haben, dass sie zehn Jahre später eine klarere Ahnung davon hätten, wer sie sind. Viele stehen mit Ende zwanzig weit ratloser und frustrierter da, als sie es nach dem Schulabschluss je gewesen sind. In Amerika hat sich dafür bereits der Begriff der "Quarterlife Crisis" eingebürgert.
Offensichtlich ist also nicht jedes Ausprobieren ein produktives Ausprobieren. Als "überdrehte Erstarrung"bezeichnet es derPsychologe Stephan Grünewald, wenn man von einer Stadt in die nächste, von einem Praktikum zum nächsten, von einer Partnerschaft in die nächste hetzt und sich dennoch in einer einzigen Warteschleife gefangen fühlt.
Die Angst davor, sich festzulegen, klare Entscheidungen zu treffen, regiert immer tiefer in unser Alltagsleben hinein: Jeder, der in den letzten Jahren versucht hat, eine Silvesterparty zu organisieren, dürfte die Erfahrung gemacht haben, dass die meisten Gäste nur unter Vorbehalt zusagen. Denn wer weiß, vielleicht kommt ja die "noch tollere" Einladung ins Haus geschneit . . . Nicht selten führt diese Zögerlichkeit dazu, dass manche am Schluss den Jahreswechsel allein zu Hause verbringen. Und zwar nicht, weil sie es genießen würden, um Mitternacht den Korken allein knallen zu lassen. Sondern weil sie sich wieder einmal nicht entscheiden konnten.
image
Diese verbreitete Mentalität, "sich alle Optionen offen zu halten", hat mit Chancenmaximierung nichts zu tun. Ebenso wenig, wie die panische und gleichzeitig gelähmte Hektik bei der größeren Lebensplanung mit dem Prozess des "Trial and Error" zu tun hat, in dem ich idealerweise den Weg zu mir selbst finde. Jener Prozess verlangt nämlich von mir, dass ich nach jedem "Error" einen Schritt zurücktrete und mich frage: Warum bin ich gescheitert? Warum fühlt es sich falsch an? Es bringt nichts, sich zehnmal hintereinander mit demselben Typus Mann einzulassen, wenn ich merke, dass ich jedes Mal gegen dieselbe Wand renne. Ebenso wenig bringt es, wie auf einer Perlenkette Praktikum an Praktikum zu reihen, obwohl mir längst dämmert, dass sich daraus keine vernünftige Arbeitsperspektive ergeben wird. Die Berufsberaterin Uta Glaubitz hat ein Buch über die "Generation Praktikum" und deren Schwierigkeiten geschrieben. Ihr Rat: "Die Leute sollten sich viel mehr Zeit nehmen, in sich hineinzuhorchen, um herauszufinden, welche Art von Tätigkeit sie wirklich befriedigt und auf welchem Feld sie wirklich engagiert und gut sind. Stattdessen lassen sie sich von allen Seiten einflüstern, was der Arbeitsmarkt angeblich von ihnen erwartet. In einer Zeit, in der die Trends und Parolen immer schneller wechseln, muss einen das ja verrückt machen. Die Frustration ist vorprogrammiert."
Es stimmt mich jedes Mal traurig, wenn ich Frauen wie Nina treffe. Denn die simple Wahrheit ist, dass wir nur dieses eine Leben haben - und es ein Jammer ist, wenn wir unsere besten Jahre damit vergeuden, auf den großen Startschuss zu warten. Und es macht es mich wütend, wenn ich von Frauen höre, dass sie sich danach sehnen, dass ihnen die schweren Lebensentscheidungen abgenommen werden. Am plattesten wurde diese Position in den letzten Jahren von Eva Herman vertreten, indem sie behauptete: "Wenn wir uns zum Frausein bekennen und unserer Weiblichkeit folgen, werden viele Entscheidungen wesentlich einfacher, weil sie vorgezeichnet sind." Doch auch bei einer klugen Autorin meiner Generation wie Claudia Rusch klingt dasselbe Unbehagen an der Freiheit an, wenn diese in einem Artikel für "Chrismon" berichtet, dass sie früher fünf Kinder haben wollte und mit Mitte dreißig kein einziges hat, weil sich der richtige Partner und der richtige Lebensmoment noch nicht eingestellt hätten. Und sich stattdessen fragt, ob es ihr nicht geholfen hätte, "einfach ins kalte Mutterschaftswasser geworfen zu werden".
Generationen von Frauen vor uns und Millionen von Frauen in anderen Teilen der Welt träumen davon, wenigstens über die grundlegenden Aspekte ihres Lebens selbst entscheiden zu dürfen. Nur wir Luxusweibchen empfinden diese Freiheit als Last und träumen deshalb laut oder leise davon, dass sie uns wieder abgenommen wird?
Mein persönliches Schlüsselerlebnis war der 11. September 2001, an dem mir klar wurde, dass der Reiz unseres heutigen westlichen Lebensstils eben nicht nur darin besteht, zwischen fünf Sorten Cola und fünfhundert Handtaschen wählen zu können. Sondern dass sich in ihm eine existenzielle Freiheit ausdrückt, die manchmal schwer zu verkraften und noch schwerer zu gestalten ist - und dennoch die beste Lebensform, die die Menschheit bislang zustande gebracht hat. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als diese Lebensform zu verteidigen - anstatt sie selbst von innen heraus zu zersetzen, indem wir uns wie verwöhnte, gelangweilte und gleichzeitig verängstigte Kinder benehmen.
Akzeptieren wir, dass wir in einer verwirrenden, unübersichtlichen Welt leben! Jeder von uns. Ganz gleich, ob Mann oder Frau. Mögen die Cinderellas aufhören, vom Prinzen zu träumen, der sie auf seine starken Arme hebt und über die Schwelle zu ihrem eigenen Leben trägt, und mögen die Peter Pans begreifen, dass es nichts bringt, jede Nacht mit "Frauen, wunderbaren Frauen" abzuhängen, um sich davon abzulenken, dass auch sie noch lange nicht im eigentlichen Leben angekommen sind! Und wenn wir endlich erkannt haben, dass nur wir selbst imstande sind, uns mit unserem Leben auszusöhnen, und diese schwierige Aufgabe keinem anderen mehr aufbürden wollen - dann finden wir eines Tages vielleicht auch den Job, der uns befriedigt; den Freundeskreis, der nicht nur aus nützlichen losen Kontakten besteht; das Zuhause, in dem wir die Bilder an die Wände dübeln und nicht nur dagegenlehnen; und zu guter Letzt auch den Partner, an dessen Fell wir uns wärmen können, wenn uns die kalten Winde der Freiheit wieder einmal allzu garstig um die Ohren pfeifen.
Und worauf warten Sie eigentlich? www.brigitte.de/dossier
THEA DORN, 37, studierte Philosophie
und veröffentlichte mit 24 ihren ersten Roman "Berliner Aufklärung", für den sie den Raymond-Chandler- Preis erhielt. 2006 erschien nach weiteren Romanen ihr Sachbuch "Die neue F-Klasse. Wie die Zukunft von Frauen gemacht wird". Thea Dorn lebt in Berlin, moderiert die Büchersendung "Literatur im Foyer" beim SWR und den Arte-Kulturtalk "Paris-Berlin. Die Debatte". Ihr neuester Roman "Mädchenmörder" erschien im Februar (336 S. 19,95 Euro, Manhattan)