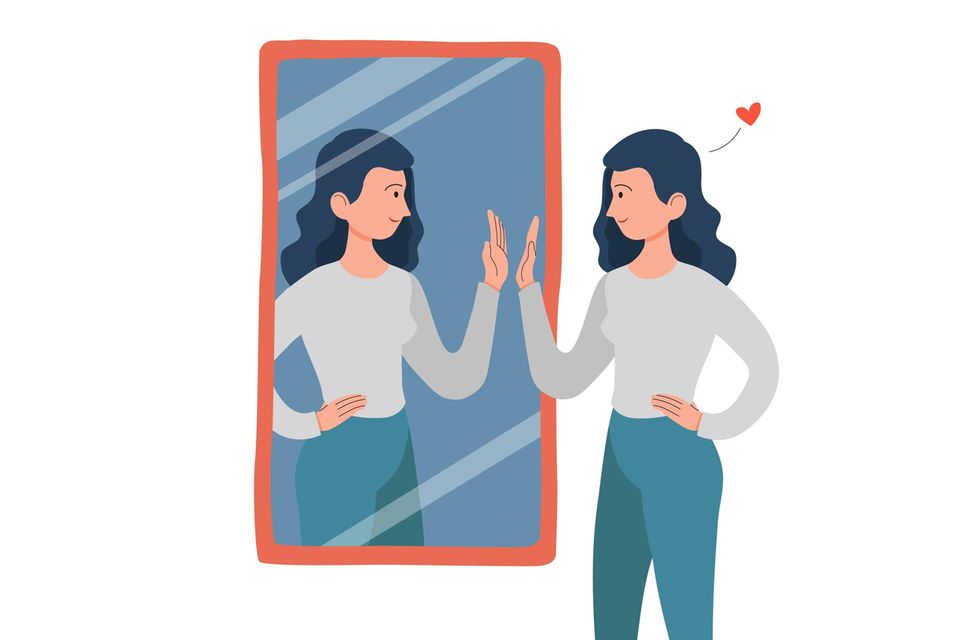"Ich habe mich für diesen Mann entschieden"
Sie waren seit drei Monaten zusammen, als Markus sie nachts weckte, weil er ihr unbedingt etwas erzählen musste: "Ich bin manisch-depressiv". Im ersten Moment wäre Daniela* am liebsten davon gelaufen. Am nächsten Morgen wünschte sie sich, das nur geträumt zu haben. Es sollte so bleiben, wie es bisher gewesen war: romantisch, vollkommen verliebt und intensiv. Sie waren schon zusammengezogen, hatten sich ein gemeinsames Leben aufgebaut in der kurzen Zeit. Mit Eifer hatten sie die Wohnung eingerichtet, neue Möbel gekauft. Mitten in der Nacht rückte Markus Schränke und Regale hin und her, brachte Lampen an. Daniela hatte viele seiner Freunde kennen gelernt, sie waren viel auf Partys, eigentlich ständig auf Achse. Manchmal fragte sie sich, woher er die Energie nahm. Aber sie genoss es. Es war die wunderbare Anfangsphase einer neuen Beziehung - eine manische Phase, weiß Daniela heute.
In dieser Nacht erzählte Markus ihr noch sehr viel mehr: Er hat sehr viel Schulden, seit Jahren lebt er auf Pump. In der Manie kauft er hemmungslos - Stereoanlagen, Fernseher, Autos. Nichts davon kann er sich leisten. Mit 35 ist er noch an der Universität eingeschrieben für Volkswirtschaft. Er scheitert immer wieder an derselben Klausur. Wenn es ihm gut geht, meldet er sich erneut an, fällt aber durch. Hin und wieder hat er Gelegenheitsjobs, bis er es nicht mehr aushält, im Büro mit anderen zusammenzuarbeiten. Stress erträgt er nicht. Den letzten Job machte er von zu Hause aus, aber sie haben ihn rausgeworfen. Seine Freunde ahnen nichts von seiner Krankheit: In den depressiven Phasen zieht er sich einfach zurück.
Hätte sie etwas ahnen können? Daniela fühlte sich überfordert, sie wusste nicht, wie sie ihm helfen konnte. Aber ihn jetzt aufgeben? Vor seinem Hilferuf davon laufen? "Mir war immer klar, dass ich mich nicht trennen will. Zusammenzuziehen ist für mich ein wichtigerer Schritt als heiraten. Ich habe mich für diesen Mann entschieden, ich werde für ihn da sein" sagt sie.
*Namen von der Redaktion geändert
Anfangs war sie vorsichtig: Die depressive Phase hatte begonnen. Er verließ das Haus nicht mehr, lag nur noch im Bett. Sie schaute sich das eine Woche lang an. Dann setzte sie sich an den Computer, suchte nach Selbsthilfegruppen, Erfahrungsberichten, Anlaufstellen. Der erste Schritt: Sie ließ sich bei der Justizvollzugsanstalt beraten, wie man die Schulden in den Griff bekommen kann. Daniela ist ein Rätsel, wie er es überhaupt geschafft hat, immer neue Kredite irgendwo rauszuleiern. In Zukunft wird ihm ein Berater zur Seite stehen, der sein Geld verwaltet. Markus wird nur ein Taschengeld zur freien Verfügung haben. Die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Aber Daniela hat ihm klar gemacht, dass sie mit den Geldangelegenheiten nicht direkt zu tun haben will, das wäre zu viel Verantwortung. Und er weiß, dass sich etwas ändern muss - für Daniela. Seit sieben Jahren macht er schon eine Gesprächstherapie. Der Therapeut hat ihm oft geraten, auch eine Neurologin aufzusuchen. "Ich habe ihn einfach genommen und bin zu einer Neurologin gefahren. Habe so lange bei der Sprechstundenhilfe insistiert, bis wir einen Termin bekamen. Bin mit ihm im Wartezimmer gesessen. Die Ärztin hat sofort verstanden. Sie hat ihm Medikamente gegeben, die nächsten Termine sind schon ausgemacht. Ich werde ihn vor der Arbeit hinbringen, nur nach der Arbeit muss er alleine zurück".
Daniela organisiert, plant und hilft ihrem Freund. Ihr eigenes Leben hat sie auf Eis gelegt. Wenn sie abends nach Hause kommt, ist sie ganz für ihn da. Was bei der Arbeit passiert ist, vergisst sie dann, nur er ist wichtig. Sie weiß: in dem Moment, wenn sie den Schlüssel im Schloss umdreht, beginnt sein Tag. Dann lebt er auf, breitet seine ganze Seele vor ihr aus, lädt alle trüben Gedanken ab: seine Angst, nie ein normales Leben führen zu können, ein Versager zu bleiben, nichts wert zu sein. Auch sie wird ihn irgendwann verlassen, fürchtet er manchmal, schließlich hat sie etwas Besseres verdient. "Mit Floskeln wie 'das wird schon' kann ich ihm natürlich nicht helfen. Ich versuche, seine Gedanken zu verstehen, mich ganz auf ihn einzustellen. Die Gespräche mit mir sind für ihn schon anstrengend" sagt Daniela. Aber sie hat auch Angst, etwas falsch zu machen. Im Internet findet sie zwar Ratschläge, aber die sind oft auch widersprüchlich. Irgendwo steht, dass es helfen kann, ein Tagebuch zu führen. Anderswo heißt es, das verleite in der Depression nur dazu, sich wieder und wieder sich mit den negativen Gedanken zu beschäftigen.
"Wie war es bei der Arbeit?" es gibt Tage, an denen er sie so begrüßt. Dann ist es ein bisschen wie ganz normaler Alltag. Manchmal kann sie ihn überreden, mit einkaufen zu gehen. Meistens strengt es ihn aber zu sehr an. Auch sich alleine zu waschen, schafft er nicht. "Er ist schon wie ein kleines Kind, für das ich ständig da sein muss", sagt sie. Ist das nicht zuviel? "Ich bin ein sonniges Kind." meint Daniela. Sie ist zuversichtlich, dass sich Markus Leben mit ihrer Hilfe verändern wird, auch wenn sich mehr Unterstützung von außen wünschen würde. Sie fühlt sich allein gelassen. Eine Tagesklinik wäre sicher sinnvoll, dann wäre er aufgehoben, während sie arbeitet, und hätte eine Aufgabe. Aber als sie es einmal ansprach, machte er sofort zu. Sie möchte ihn nicht zu sehr unter Druck setzen: "Ich akzeptiere seinen Wunsch. Ich bin einfach für ihn da. Ich fahre viel Auto. Wenn ich einen Verkehrsunfall hätte, wäre er auch an meiner Seite. Das weiß ich."
"Nachher habe ich mich schrecklich geschämt"
Monika Wolff (49) ist selbst manisch-depressiv. Seit neun Jahren arbeitet sie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim als Patientenfürsprecherin und betreut die Angehörigen Betroffener. Für Brigitte.de schildert sie ihre Erfahrungen und sagt, wie sie die Situation von Markus und Daniela sieht.
"Verliebtheit ist ja für die meisten Menschen eine Ausnahmezustand. Für einen Maniker bedeutet es richtigen emotionalen Stress, der einen neuen Schub auslösen kann", sagt Monika Wollf über die Geschichte von Markus. Daniela konnte nichts ahnen: "Maniker selbst wissen oft lange nichts von ihrer Krankheit. Die Manie ist eine tolle Zeit mit unglaublich viel Ideen und Energie. Man plant immer irgendetwas." Viele Maniker machen Schulden: Monika hat einmal erlebt, wie ein Patient sich drei Porsche bestellte, weil er einen Handel eröffnen wollte. Sie selbst hat sich nicht verschuldet, nur mal in die Manie übermäßig eingekauft, bunte Kleider, die sie später nie getragen hat. "Maniker können sehr überzeugend sein. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie es, so wie Markus, schaffen, sich immer wieder Kredite zu besorgen. Maniker ziehen ihre Mitmenschen häufig in den Bann, sie sind oft eloquent und unterhaltend. Sie kommen schnell mit anderen in Kontakt", weiß sie aus ihrer Arbeit im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim.
Sie selbst erlebte die erste manische Phase 1986: Sie hatte eine schwere Operation hinter sich, lag im Krankenhaus. "Nachts lief ich durchs ganze Gebäude, ging auch nach draußen - Angst kennt man in der Manie nicht. Ich schlief kaum, übernahm mich vollkommen. Typisch für die Manie - man gönnt sich wenig Ruhe, schläft nicht." Sie wurde aus dem Krankenhaus ins Institut für seelische Gesundheit überwiesen.
Wie viele Maniker wurde Monika Wolff auch aggressiv: Sie beleidigte und verletzte Menschen, die ihr eigentlich sehr nahe stehen. Was sie sagte, war zwar tatsächlich ihre Meinung. Aber sie sagte es so übertrieben, direkt und hart, wie sie es sonst nie tun würde. Als sie aus dem Krankenhaus kam, musste sie sich erst einmal bei Familienangehörigen und Freunden entschuldigen. Sie schämte sich schrecklich: "Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, mal in die Politik zu gehen. Aber in der Manie habe ich dann groß rum getönt, meine politische Laufbahn sei schon in die Wege geleitet. Ich traute mir dann alles Mögliche zu." Es dauerte drei Schübe, bis sie sich eingestand, dass sie wirklich Hilfe benötigte. "Zwischendurch habe ich immer wieder versucht, die Medikamente abzusetzen - wie die meisten Betroffenen." sagt Monika Wolff über die ersten sechs Jahre nach der Diagnose. "Aber die Episoden kamen wieder und sie wurden tiefer und schlimmer. Heute nehme ich die Medikamente, so wie ein Diabetiker Insulin nimmt". Außerdem macht sie eine Therapie. Mit ihrem Arzt und ihrer Therapeutin hat sie eine Art Vertrag abgeschlossen, was diese für sie unternehmen sollen, wenn sie Veränderungen an ihr bemerken. Ihr persönliches Frühwarnsystem funktioniert: 1994 hatte sie den letzten Schub.
Von Beruf ist Monika Wolff eigentlich Erzieherin. Als es ihr besser ging, wollte sie zurück in den Beruf, vielleicht in einem Kinderheim arbeiten. Ihr Arzt hatte eine bessere Idee: Er schlug ihr vor, die Angehörigengruppen zu betreuen. Seit neun Jahren ist sie nun dabei.
Sie hatte Glück, glaubt sie: Sie war dreißig, hatte ihre Lebensweg gefunden, als die Krankheit diagnostiziert wurde. In der Zusammenarbeit mit den Angehörigen erlebt sie oft, wie schwierig es ist, wenn junge Leute in der Krise ihre Ausbildung gefährden so wie Markus. Die Eltern machen sich dann große Sorgen, dass ihre Kinder nie mehr Fuß fassen, die Schule oder das Studium nicht beenden. Neulich drohte in einer Angehörigengruppe ein Vater, seinen manisch-depressiven Sohn rauszuschmeißen. Monika Wolff machte ihm klar, dass der Sohn sehr aggressiv reagieren, der Konflikt sich hochschaukeln wird.
Sie selbst hatte auch mit ihrem Umfeld Glück: Kaum jemand von ihren Freunden und Verwandten hat sich von ihr zurückgezogen. Auch wenn es ihnen oft schwerfiel zu verstehen, was mit ihr passierte. Aggressionen und Beleidigungen waren vergessen, wenn sie Monikas ehrliche Reue sahen. Manche wussten auch einfach nicht, wie sie sich verhalten sollten, hatten Angst etwas Falsche zu tun oder zu sagen.
Diese Unsicherheit erlebt Monika nun in ihrer täglichen Arbeit den Angehörigen. Die haben viele Fragen, es tut ihnen gut, sich untereinander auszutauschen. Sie reagieren oft zunächst erstaunt, wenn sie hören, dass Monika selbst Betroffene ist, denn man merkt ihr nichts an. Ihre Geschichte nimmt den Angehörigen ein Stück ihrer größten Angst - dass der Betroffene nie wieder ins normale Leben zurückfinden könnte. Sie ist froh, offen über ihre Geschichte reden zu können.
Sie rät den Angehörigen, den Manikern eine Struktur im Alltag zu geben, sie an die Hand zu nehmen. "Mein Vater hat es einmal schön ausgedrückt: Ich reiche dir die Hand, aber aufstehen musst du selbst", erzählt sie. Die Unterstützung von Familien und Freuden hat ihr sehr geholfen, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie findet es deshalb bewundernswert und ehrenhaft, wie Daniela sich für Markus einsetzt. Aber sie glaubt auch, dass Daniela sich möglicherweise zu viel aufbürdet, nicht genug nach sich selbst schaut. "Maniker rauben ungeheuer viel Energie." Sie kann Danielas Gefühl, alleine gelassen zu sein, deshalb gut verstehen. Auch für die Angehörigen ist Unterstützung sehr wichtig.
Beim Relaunch von BRIGITTE.de wurden leider alle Kommentare in diesem Artikel gelöscht, die vor dem 3. Februar 2009 geschrieben wurden. Hier können Sie den Artikel im alten Layout sehen und sich die Kommentare durchlesen.