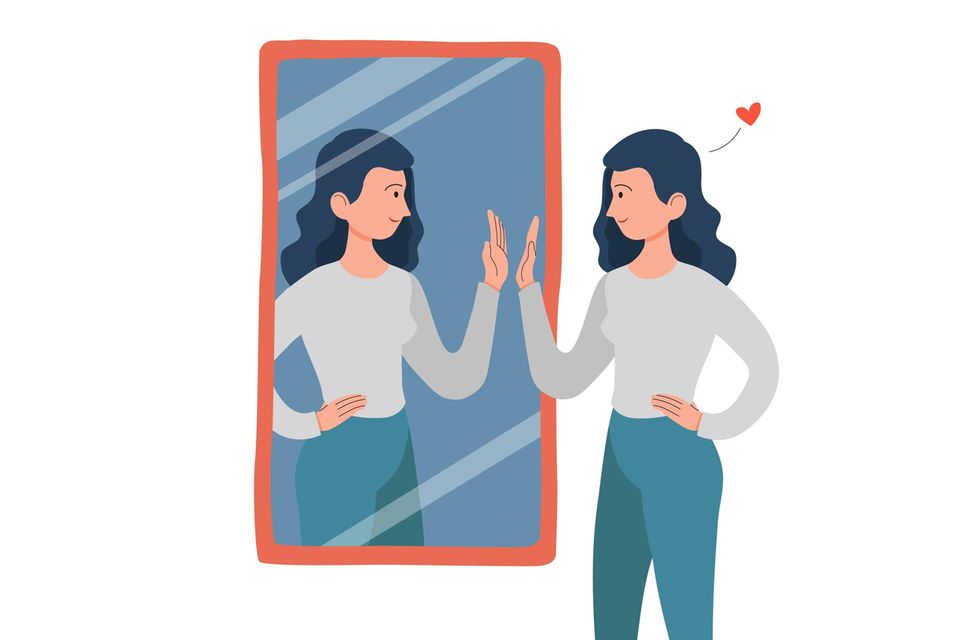BRIGITTE: Frau Malich, fast 90 Prozent der Befragten unserer Studie denken, dass heute über persönliche, auch intime Themen offener gesprochen wird als noch vor ein paar Jahren. Stimmt dieser Eindruck?
Lisa Malich: Ja. Man muss nur bestimmte Medienereignisse ansehen. Es war noch in den 90er-Jahren nicht üblich, dass bekannte Persönlichkeiten öffentlich über Depressionen oder persönliche Probleme sprechen. Heute ist das aber der Fall. Ein aktuelles Beispiel sind Prinz Harry und Meghan Markle, die ein sehr breitenwirksames Interview über ihre familiären Probleme und auch Ängste gegeben haben. Oder Sportlerinnen wie Naomi Ōsaka und Simone Biles, die ganz offen über ihre psychischen Probleme reden. Und diese Geschichten sind nicht nur einem Nischenpublikum bekannt, sondern wurden von allen großen Medien aufgegriffen und in sozialen Netzwerken diskutiert. Wenn wir so etwas lesen, wirkt es auch auf uns zurück.
Das heißt: Weil Prominente offen über solche Dinge sprechen, fällt es auch uns selbst leichter?
Ja, auch wenn es natürlich eine Wechselwirkung ist: Die Medien greifen etwas aus der Gesellschaft auf, was wieder auf uns zurückwirkt. Es ist ein Feedback-Effekt. Die Art und Weise, wie andere Menschen über die Psyche sprechen und was wir darüber lesen, verändert wiederum auch unsere Selbstwahrnehmung und wie wir selbst darüber sprechen können.
Was hat denn diese sich selbst verstärkende Entwicklung angestoßen?
Das ist ein längerer Prozess und hängt sehr stark mit einer veränderten Gefühlskultur in westlichen Gesellschaften allgemein zusammen. Es fängt sogar schon grob um 1900 an, als die Psychoanalyse zu einer therapeutischen Praktik aufstieg. In den 1960er-Jahren begannen in Deutschland viele Krankenkassen, die Kosten einer Psychotherapie zu übernehmen, was den Zugang dazu erleichtert hat. In den 1970erJahren gab es einen richtigen Psycho-Boom, auch aus der Studentenbewegung heraus, also den Drang, sich mit der Psyche und dem eigenen Selbst zu beschäftigen, durch Esoterik und Selbsterfahrung, aber auch die krankenkassenfinanzierte Psychotherapie wuchs in der Zeit enorm. Nun könnte man natürlich wiederum fragen: Woran liegt es, dass die Psyche für westliche Staaten so wichtig wurde?
Ja, woran?
Viele sagen, dass es mit der Individualisierung zusammenhängt. Das individuelle Glück wurde immer wichtiger, und damit auch die Beschäftigung mit dem psychischen Wohlbefinden. Eine andere These besagt, dass es auch mit dem neoliberalen Kapitalismus zusammenhängt. Denn natürlich ist auch die Anzahl kommerzieller Angebote sehr gewachsen, die sich mit der Psyche befassen, man sehe sich nur die ganzen Coachings und Ratgeber an. Das ist sicher auch ein Faktor.
Warum fällt es Frauen leichter, über beispielsweise psychische oder Beziehungsprobleme zu sprechen, wie ja auch unsere Umfrage zeigt?
Ich fand es erstaunlich, wie gering der Unterschied hier ist. Denn natürlich gab es lange das Rollenstereotyp vom Mann, der relativ wenig enge soziale Beziehungen hat, wenig emotional ist, Probleme rational löst und wenig darüber redet, während die Frau tendenziell offener ist, was ihr Gefühlsleben angeht. Aber das scheint sich im Alltag mehr und mehr zu verändern. Es war auch lange Zeit so – und ist immer noch so –, dass weitaus mehr Frauen Psychotherapiepraxen aufgesucht haben als Männer, aber auch dieser Unterschied nimmt ab. Ein interessanter Unteraspekt dabei ist, dass Einkommen und Bildungsgrad eine große Rolle zu spielen scheinen. Wer einen höheren Bildungshintergrund mitbringt, hat eher gelernt, über sich selbst zu reden. Die Soziologin Eva Illouz hat in ihrem Buch "Gefühle in Zeiten des Kapitalismus" beschrieben, dass der neue Umgang mit Gefühlen und Beziehungen auch eine Art Kapital ist, das sich in bestimmten bürgerlichen Schichten mehr angehäuft hat als in anderen, wo es noch nicht so eingeübt ist.
Auch jüngeren Menschen scheint tendenziell das Reden über solche Themen leichter zu fallen als älteren.
Ja, das ist ganz sicher ein Generationenwechsel in Bezug auf Offenheit und die Psyche. Zum einen gibt es eine veränderte Mentalität, auch durch Popkultur und neue Medien, in die Jüngere hineinsozialisiert wurden. Zum anderen ist es so, dass viele jüngere Menschen bei uns auch viel früher in Kontakt zu psychologischen und psychotherapeutischen Angeboten kamen als ihre Eltern. In den letzten Jahren wurden Angebote wie Kinder- und Jugendpsychotherapie, Schulpsychologie und Sozialpädagogik stark ausgebaut. Ich denke, auch dadurch entstand eine andere Gefühlskultur.
Unsere Umfrage zeigt: Eine große Mehrheit findet es gut und wünschenswert, dass mehr über persönliche Themen gesprochen wird. Trotzdem sagen 68 Prozent, dass es mindestens ein Thema in ihrem Leben gibt, über das sie mit keinem Menschen reden. Woher kommt diese Diskrepanz?
Es liegt nahe, dass es immer noch Tabus gibt. Menschen haben ja ein Gefühl dafür, wo der vermeintlich "normale" Bereich liegt. Es gibt immer noch eine Scham, wenn man bestimmten Vorstellungen nicht entspricht, das kann Sexualität genauso betreffen wie das eigene Gehalt.
Gerade, was Sexualität angeht, könnte man ja denken, dass wir heute schon recht offen damit umgehen. Dennoch spricht ein Viertel aller Befragten mit keinem anderen Menschen über das eigene Sexualleben, also noch nicht mal mit dem/der eigenen Partner*in. Das finde ich schon erstaunlich.
Ich denke, dass es heute leichter fällt, über Sexualität zu sprechen, wenn sie dem eigenen Glück dient. Dass man heute dank der sexuellen Revolution eher als früher über bestimmte Grenzüberschreitungen spricht, wenn sie mit Lust verbunden sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es anders aussieht, wenn es um sexuelle Unlust geht, um wenig Sex bei Paaren, Potenzprobleme bei Männern, um Missbrauchserfahrung. Etwas, was dem Bild vom befreiten, glücklichen Ich entgegensteht, wird womöglich weniger kommuniziert. Ich denke, das gilt für andere Themen auch: Über Armut spricht man weniger gern als über Reichtum. Man erzählt auch eher Geschichten von überwundenem Leiden – ich hatte Probleme, aber jetzt habe ich sie nicht mehr – als über die Themen, die nicht leicht zu lösen sind und wo vielleicht auch eine Verletzung geblieben ist.
Wäre es denn gut, wenn auch das jeder und jede offen erzählen würde?
Die ideale Gesellschaft wäre eine, wo man das erzählen könnte und nicht diskriminiert würde. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es immer noch Diskriminierung, Ungleichheit und Gewalt gibt, und ich kann verstehen, wenn Menschen etwas nicht erzählen, um sich nicht der Gefahr eines Angriffs auszusetzen. Das zu ändern muss eine Gesamtbewegung sein. Ich finde es daher gut, um wieder auf den Anfang des Gesprächs zurückzukommen, wenn Prominente – also Menschen mit oft hoher sozialer Position, finanziellen Ressourcen und viel Reichweite, die vergleichsweise geringere Risiken eingehen – über psychische Probleme oder ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung reden und darüber berichtet wird. Es wird ja oft unterstellt, es ginge ihnen nur um Selbstvermarktung. Aber ich glaube, dass zumindest teilweise genuines Interesse da ist, etwas zu verändern.
Prof Dr. phil Lisa Malich ist Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Historikerin. Sie arbeitet und forscht an der Universität Lübeck zur Wissensgeschichte der Psychologie und Psychotherapie.