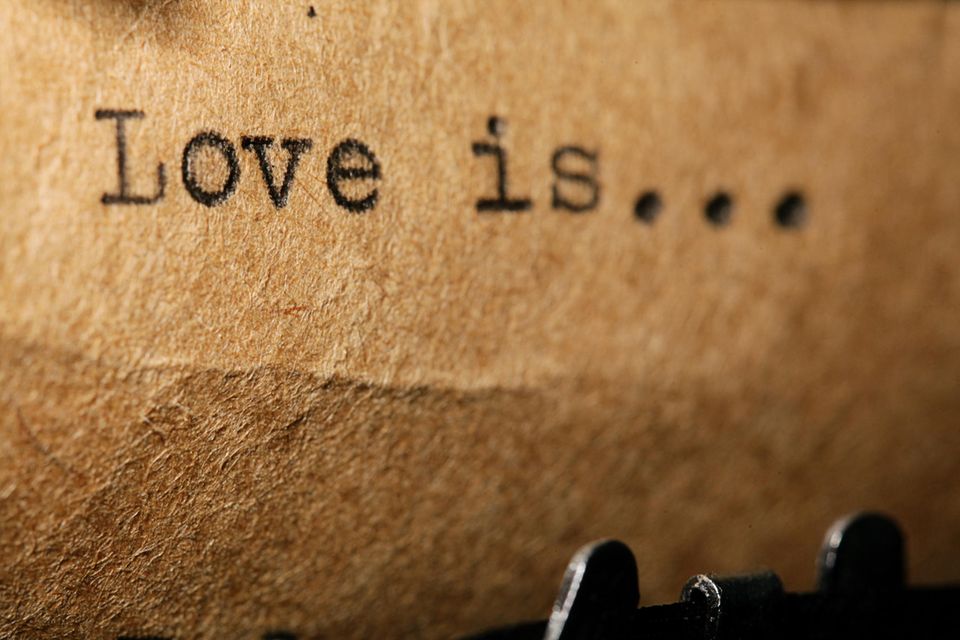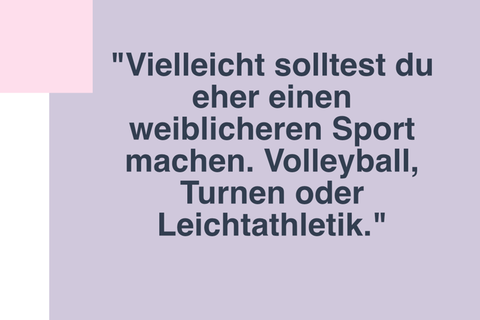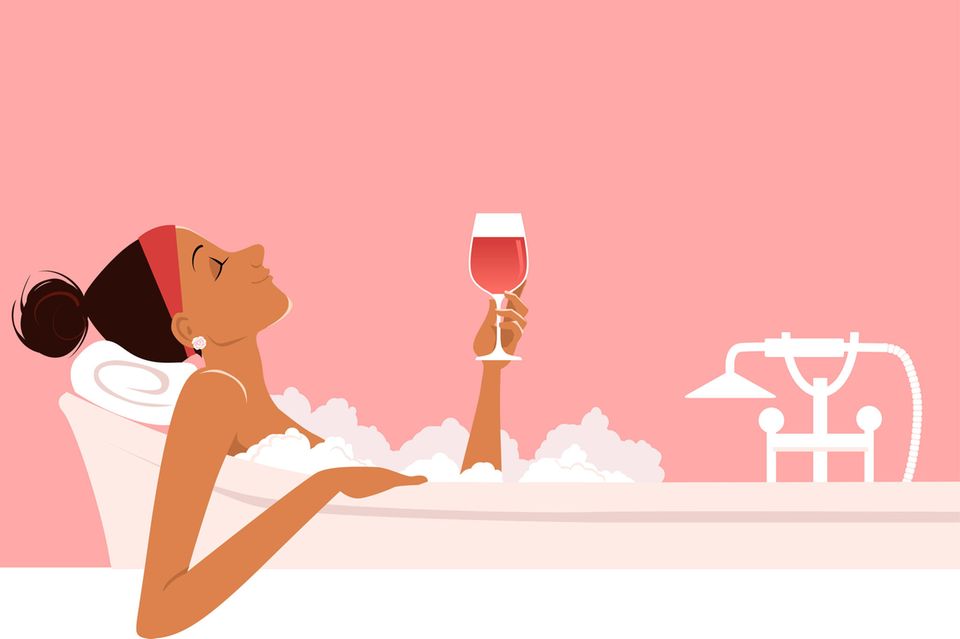Auf dem "fluctoplasma", einem interdisziplinären Kunstfestival in Hamburg, das eine Bühne für diverse Perspektiven von Künstler:innen, Kollektiven und Redner:innen bietet, stellte kürzlich Josephine Apraku das eigens geschriebene Buch "Kluft und Liebe: Warum soziale Ungleichheit uns in Liebesbeziehungen trennt und wie wir zueinanderfinden" vor – und ich fühlte mich ertappt.
Ich sehe mich gerne als akzeptierenden, reflektierten und Normen kritisch hinterfragenden Menschen an – als queere Person ist für das eigene Seelenheil gerade die letzte Eigenschaft sehr wichtig. Schließlich lebe ich – und leben wir alle – in einer Gesellschaft, die normativ ist, was meint, dass ein Mensch im "besten Fall" weiß, heterosexuell und cisgeschlechtlich ist (sich also mit dem Geschlecht identifiziert, dass ihm:ihr bei der Geburt zugewiesen wurde).
Doch als Josephine eine Passage aus dem Buch vorlas, erwischte ich mich dabei, wie ich in die normative Falle tappte und stellte erneut fest, wie verwurzelt Diskriminierung in meinem Kopf ist – und wohl in den Köpfen vieler Menschen.
"Wie hast du dir diese Personen vorgestellt?"
Im Ausschnitt aus dem Buch geht es um zwei Menschen, die sich in der S-Bahn begegnen. Die eine Person beobachtet die andere, wie sie in einem Buch liest und ist neugierig. "Wenn du nach drei Stationen immer noch da sitzt, spreche ich dich an", denkt sie sich und tut es tatsächlich.
Die beiden kommen ins Gespräch, gehen etwas essen, verbringen eine schöne Zeit zusammen. Beim Imbiss geht die andere Person in den Laden, spricht mit den Inhaber:innen auf Türkisch und kommt zurück. Über Wochen verbringen die beiden Zeit miteinander, bis die eine zu der anderen wie beiläufig sagt: "Ich liebe dich."
"Wie hast du dir diese Personen vorgestellt?", fragt Josephine anschließend in den Raum. Tatsächlich wussten wir Zuhörenden nur, dass eine der beiden Personen türkisch spricht. Mehr nicht. Doch für meinen Kopf reichte es schon aus, dass ich die vorlesende Person als Frau gelesen habe (Joesphine ist nicht-binär und nutzt keine Pronomen) – also war für mich schon einmal klar, dass es sich bei der einen Person in der Geschichte wohl auch um eine Frau handelt. Und automatisch dachte ich bei der anderen Person an einen Mann.
Genaugenommen an einen cis Mann mit schwarzen Haaren und Bart und dunkler Haut, ganz so, wie sich mein klischee- und vorurteilbehaftetes Gehirn einen Menschen vorstellt, der aus der Türkei kommt – denn warum sonst sollte die Person sonst türkisch sprechen? Und wie sonst sollte eine Person aus der Türkei aussehen?
Es gäbe unzählige mögliche Gründe, unzählige andere äußerliche Eigenschaften, aber instinktiv sah ich nur diese eine Möglichkeit und hinterfragte nichts davon. Erst, als Josephine uns allen die Fragen stellte, auf die wir hätten selbst kommen können, bemerkte ich mein eigenes Denken: "War die Person weiß? Of Color? Ein Mann oder eine Frau? Welche Geschlechtsidentität hatte sie? Hatte sie eine Behinderung?"
An viele der Möglichkeiten hatte ich überhaupt nicht gedacht, doch bevor ich in Selbstkritik zerging, brachte Josephine einen wichtigen Gedanken auf den Punkt: "Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass man gegen Diskriminierung sein kann und sie trotzdem reproduziert." Wir seien schließlich alle in unterschiedliche Formen der Unterdrückung eingebettet.
Unsere Vorstellung von Liebe ist auch geprägt durch Medien und (fehlende) Repräsentation
Diese Unterdrückung geschieht überall: auf der Straße, in unserem Zuhause, in den Medien. Laut dem "Hollywood Diversity Report 2022" hat sich die Zahl der Hauptrollen, die von People of Color gespielt wurden seit 2011 nahezu vervierfacht: So spielten 18 Prozent von Schwarzen Menschen die Hauptrolle – wobei sie 13,4 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung ausmachen und damit laut dem Report "leicht überrepräsentiert" waren. Anders sah es beispielsweise bei Menschen lateinamerikanischer Herkunft (Latinx) aus. Sie spielten in 7,7 Prozent der Fälle die Hauptrolle, stellen allerdings 18,7 Prozent der US-amerikanischen Bevölkerung dar und waren damit "äußerst unterrepräsentiert."
Immerhin: Es tut sich also etwas in der Medienlandschaft. Serien wie "Euphoria" (in der Zendaya, eine Person of Color, die Hauptrolle spielt) und Filme wie "Moonlight" (ebenfalls mit People of Color in den Hauptrollen) sind keine Randerscheinung mehr, sondern im Mainstream angekommen. Dennoch ist die Liebe, wie sie uns in den Medien gezeigt wird, größtenteils vor allem eins: weiß. Und privilegiert, denn oftmals haben sie Zugang zu Geld, sind körperlich nicht eingeschränkt, cisgeschlechtlich und heterosexuell.
Diese Vorstellungen von Liebe, diese "normierte Attraktivität", wie Josephine sie umschreibt, bestimmt unsere Einstellung zu Beziehungen – und zu den Menschen, mit denen wir eine Beziehung eingehen würden.
Was intersektionale Diskriminierung bedeutet
Meine Vorstellung von Liebe und Beziehung war – und ist es vielleicht noch immer – definitiv von den Medien und der Gesellschaft geprägt. Schon als queere Person fühlte und fühle ich mich nur bedingt überhaupt repräsentiert, weswegen ich als Kind beim Schauen von Disney-Filmen eher in die Rolle der Prinzessin schlüpfte, die die große Liebe in ihrem (weißen, reichen, heterosexuellen, cisgeschlechtlichen und körperlich uneingeschränkten) Prinzen fand.
Später stellte ich mir meinen Traummann als jemanden vor, der entfernt an den Schauspieler Adam Driver erinnert: groß, recht muskulös, mit kantigem Gesicht und schwarzem, welligen Haar. Die Liebe fand ich ganz woanders und nicht einmal bei einem Mann, sondern einer nicht-binären Person.
Diskriminierung erfahren wir beide durch die Gesellschaft, aber eben auf unterschiedliche Weise und verschiedenen Ebenen, was der Begriff "intersektionale Diskriminierung" meint: Wir, beide weiß und zumindest äußerlich männlich gelesen, haben als queere Personen andere Herausforderungen zu bewältigen als beispielsweise eine queere Person of Color mit Behinderung. Ich als cis Mann habe wiederum andere Erfahrungen beim Thema Geschlechtsidentität gemacht als mein:e Partner:in, dem:der von vielen Teilen der Gesellschaft genau diese grundsätzlich abgesprochen wird.
Niemand sei je nur Schwarz oder queer oder eine Frau, oder, oder, so Josephine in der Lesung auf dem "fluctoplasma". Die Identität ist immer eine Mischung verschiedener Faktoren wie der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung, der Religionszugehörigkeit und nicht zuletzt dem Geburtsort und der Zeit, in der man geboren ist.
Dass mein:e Partner:in und ich heiraten dürfen, ist noch nicht lange vom Staat "gestattet", dafür schreibt er uns sehr genau vor, ob und auf welche Weise wir beispielsweise Kinder bekommen dürfen. Und in der Heiratsurkunde wie auch bei den Adoptionsanträgen wird höchstwahrscheinlich von meinem Liebesbeziehungsmenschen als "Mann" die Rede sein – und nicht als der Mensch, der er:sie ist.
"Die Utopie ist vielleicht einfach der Versuch, Unterdrückung zu begegnen"
Beim Thema intersektionale Unterdrückung gehe es nicht darum, welche Menschengruppen stärker oder minder diskriminiert werden, sagt Josephine. "Wir sind da alle drin und das Leben ist einfach kompliziert." Vielmehr müsse es darum gehen: Können wir das in unserer Beziehung ansprechen? Wie werden wir für andere Personen ansprechbar, wie können wir ansprechen? Auch über unsere Liebesbeziehung hinaus. Wenn mein:e Partner:in Diskriminierung erfährt aufgrund seiner:ihrer Geschlechtsidentität – bin ich für ihn:sie da? Auf welche Weise kann ich es sein?
Das "fluctoplasma"-Festival stellt auch die Frage nach Utopien: In welcher wollen wir leben? Und welche Zukunftsbilder müssten dabei unbedingt entsorgt werden? Wie könnte eine alternative Version der Gesellschaft aussehen, die Vielfalt lebt und feiert? Bei der Lesung des Buches war der Autor Fikri Anıl Altıntaş an der Seite von Josephine und führte mit durch den Abend. Seine Antwort auf diese Fragen gibt einen möglichen Weg vor: "Vielleicht ist die Utopie der Versuch, Unterdrückung zu begegnen."
Wir alle sind in verschiedene Formen der Unterdrückung eingebettet, wir alle reproduzieren manchmal – bewusst oder auch unbewusst – Diskriminierung auf unterschiedliche Weise, auch und vor allem in unseren Beziehungen. Sich dessen gewahr zu werden, in den Dialog zu treten, miteinander den Versuch zu unternehmen, dieser Unterdrückung zu begegnen; das ist vielleicht die Utopie, die wir anstreben sollten. Für unsere Liebsten und nicht zuletzt auch für uns selbst.
Josephine Apraku ist Afrikawissenschaftler:in und Referent:in für intersektionale rassismuskritischekritische Bildungsarbeit. Als Lehrbeauftragte:r hat Josephine Apraku unter anderem an der Alice Salomon Hochschule und der Humboldt-Universität zu Berlin unterrichtet und als Kolumnist:in für Magazine wie EDITION F und Missy Magazine geschrieben.
Verwendete Quellen: bbc.com, researchgate.com, deadline.com, bpb.de, fluctoplasma.com, Lesung "Kluft und Liebe"