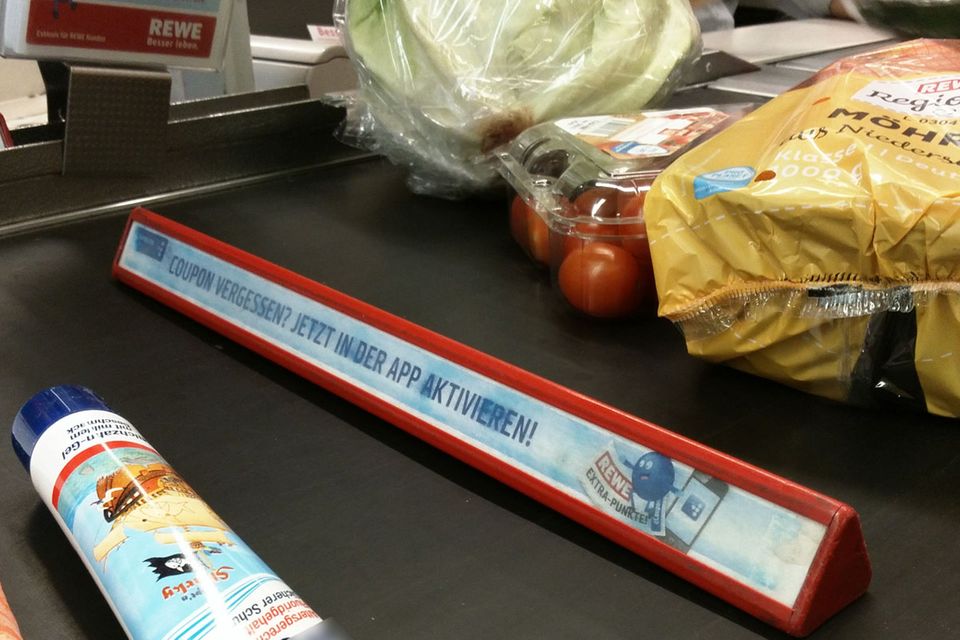image
Der Stipe. Eine fast 1,90 Meter große kroatische Sahneschnitte mit hohen Wangenknochen und dunklen, ernsten Augen. Mit einer Vorliebe für kaputte Typen. Ein echter Kerl. Auch ohne prolliges Gehabe. Mit fünf Jahren von Kroatien nach Deutschland gekommen. Wir gehen Gummistiefel kaufen, sagte der Vater zu ihm. Nach zwei Stunden wusste er, dass das eine Lüge war, dass er gerade seine Großmutter verlassen hatte und ein Leben, das nach Pinien und Thymian roch. Der Stipe, ein Gastarbeiterkind in Tübingen, der Vater Lkw-Fahrer, die Mutter Krankenschwester, ein Kind, das Schwäbisch lernte und deutscher sein wollte als die Deutschen. Kann man alles lesen über ihn.
"Ich mag das nicht", sagt Stipe Erceg. " Jedes Mal der deutsche Jugo-Kroate sein." Manchmal fragt er sich, warum er all diese Fragen beantworten soll. "Es muss doch einen Mittelweg geben zwischen Dieter Bohlen und gar nicht. Da rede ich über mein Leben, und dann liegt es bei jemandem zu Hause in der Ecke herum. Vielleicht muss man sich rar machen, das werde ich in Zukunft auch tun. Ja." Man muss sich das so vorstellen, dass dem 33-Jährigen nach seiner Rolle in "Die fetten Jahren sind vorbei" der Ruhm irgendwie vor die Füße gekippt wurde. Und dass er zunächst stolperte und nun versucht, die Mitte zu finden zwischen der Zuneigung und der Abneigung, die ihm plötzlich gleichermaßen entgegenschlagen.
Jeder Zweite hier im Prenzlauer Berg schaute Stipe Erceg an damals, ihm war das unangenehm. Er zog sich zurück, wusste nicht mehr, wie er über die Straße laufen sollte. Auf den Boden schauen? Zu ängstlich? Aufgerichtet nach vorn gehen? Zu arrogant vielleicht? Er entschied, lieber zu Hause zu bleiben. Bei seiner Frau Laura, die auch Schauspielerin ist und die er vor elf Jahren an der Schauspielschule kennen lernte. Und bei seinen beiden Söhnen, vier und zwei Jahre alt. Familie ist wichtig, sagt er. Und wenn man früh die richtige Frau gefunden hat, worauf dann warten? Die Vorstellung, allein zu bleiben, findet er grausam. Und introvertiert sei er auch. Er sei eher einer, der zu Hause sitzt und liest oder spazieren geht, wenn die Kinder schlafen.
Aber wenn man ihn spielen sieht, besonders als Fabo in "Kahlschlag", eine betrunkene, ein wenig böse Seele, die durch die Nacht wandert und innerhalb einer Filmstunde geliebt, angefahren, angeschossen und verprügelt wird, denkt man: Wie kann dieser magere Mann das mit so viel Zynismus und gleichzeitig immer anwesender Zerbrechlichkeit spielen? So einer muss doch im Inneren der Länge nach aufgerissen sein. "Ich lerne in diesem Beruf viel über mich selbst", sagt Stipe Erceg, "es ist erstaunlich, was in einem schlummert, was man sonst nicht auslebt."
Er brauche einen starken Bezug zu sich selbst. Dafür gehe er nicht mehr so radikal mit sich um wie früher, als er für die Rolle des Fabo drei Wochen lang gesoffen hat, sagt er. Heute arbeitet er anders, kräftesparender.
image
Holger Meins, den er in "Der Baader- Meinhof-Komplex" spielt, hat er sich in einer Dokumentation angeschaut. Der Märtyrer der RAF, der sich selbst zu Tode gehungert hat. Erceg sah, wie er sich bewegte, er suchte Wesenszüge, das, von dem er glaubte, dass es Holger Meins ausmacht. Und er versuchte, ihm einen Körper zu geben. Er spielte ihn zart, die Schultern hochgezogen, die Augen nach innen gekehrt. "Er war irre impulsiv, aber auch sehr sensibel, glaube ich", sagt er. "Ein Idealist. Ein verbohrter Idealist." Und dann stirbt er. Zeigt den Tod als einen Moment des Loslassens und der Befreiung, denn so hatte er auch schon Menschen sterben sehen. Da ist ihm bewusst geworden, dass es kein Auflehnen, kein Klammern ans Leben mehr gab. "Ich glaube, im Moment des Todes, da gibt es nur noch dich und Gott", sagt er. "Man ist allein. Und im allerletzten Moment erlangt man eine unglaubliche Wachheit. Und dann ist das, von dem man glaubt, dass es den Menschen ausgemacht hat, plötzlich verschwunden." Er mag das Gerede nicht um das letzte Lächeln, die schöne aufgebahrte Leiche. Als er das letzte Mal einen Toten sah, dachte er, das ist nicht schön, das ist nur ein Stück Fleisch. Denn Schönheit, das ist die Seele. Und die geht.
Glaube und Religion waren für ihn immer selbstverständliche Bestandteile des Familienlebens, seines Kulturkreises. Nur Intellektuelle machten sich Gedanken darüber, was sie glauben sollen, sagt er. Neuerdings hat seine Frau das Tischgebet eingeführt. Es gefällt ihm. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Überhaupt entdeckt er, seit er Kinder hat, viele Ähnlichkeiten mit seinem Vater, obwohl er in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen ist. Konsequenz und Strenge sind Erceg wichtig, Grenzen zeigen. Klar, man soll einem Kind keine Ohrfeige geben, aber ein Klaps auf den Hintern ist nicht unbedingt die falsche Erziehungsmethode, glaubt er.
Seine Eltern sind stolz auf ihren so bekannten Sohn. Sie reden nicht täglich dar- über, genauso wenig wie über Gefühle, die werden in seiner Familie eher gelebt und nicht ständig besprochen. "Wenn ich jemanden liebe, dann muss ich diesem Menschen nicht zehnmal am Tag sagen, dass ich ihn liebe."
Stipe Erceg war ein Kind, das gern auf der Straße war, immer unterwegs, ein talentierter Fußballer, aber zu faul, um Profi zu werden. Er feierte gern, reiste gern und machte gern Blödsinn. Nichts deutete bis zu seinem 20. Lebensjahr darauf hin, dass er Schauspieler werden würde. Ein guter Freund wollte es werden, der brachte ihn auf die Idee. Erst einmal zogen die beiden nach New York. Aber es war Februar und kalt, also setzten sie sich in einen Bus und landeten schließlich in Miami. "Dort war alles anders, viel freier", sagt Erceg. "Es gab die Kubaner, viele Homosexuelle, es war dreckig, es war warm, du konntest mit einer Flasche Bier auf der Straße herumlaufen, ohne diese lächerliche braune Papiertasche drum herum. Das war ja alles in New York undenkbar. Für uns war es eine Oase."
image
Erst als das Visum schon drei Monate abgelaufen war, kehrte er nach Deutschland zurück. Schrieb sich für Jura ein, saß in den Vorlesungen herum und verstand nichts. Die Leute empfand er als viel zu steif und dachte: "Ich habe doch 13 Jahre lang in der Schule in die Bücher geschaut, warum soll ich das jetzt noch einmal fünf Jahre lang machen?"
Dann besuchte er einen Schauspiel-Workshop und merkte schon am ersten Tag: Das war es, was er immer wollte. Plötzlich fühlte er sich, als habe er Aufnahme in ein neues Gelobtes Land gefunden. Mit 22 Jahren ging er schließlich an das Europäische Theaterinstitut. Vielleicht, sagt er, habe ihn auch sein Alter davor bewahrt, sich so naiv in diesen unbedingten Willen mancher Schüler zu werfen: Forme mich, mach was aus mir. Was gibt es da zu formen?, dachte er. Es liegt doch in meiner Verantwortung, etwas aus mir zu machen. Er fand diese Psychospiele albern, in denen man sich in pseudotranceartigen Zuständen auf den Boden wirft und schreit. "Also, bist du ein Mensch oder bist du ein Tier?", sagt er.
Dabei beherrscht gerade er diese vollkommene Nacktheit, ohne etwas von sich zu verraten. Allerdings dauerte es einige Zeit, bis er dorthin kam. Er ging nicht regelmäßig zum Unterricht, streifte lieber durch die Stadt. Bis ihn sein Schauspiellehrer Valeri Blitschenko packte und sagte: "Du bist kein Deutscher. Versuch zu verstehen, woher du stammst und worin deine eigentliche Energie und dein schöpferisches Können wurzeln. Versuch, das wieder zum Leben zu erwecken."
In "Yugotrip" spielte Erceg 2003 einen bosnischen Kriegsverbrecher und wurde dafür mit dem Max-Ophüls-Preis als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Im selben Jahr drehte er "Die fetten Jahre sind vorbei". Demnächst ist er in dem Kinofilm "Im Sog der Nacht" zu sehen. In einer Figur, die ihm am nächsten ist, wie er sagt. Ein Todessüchtiger, ein Maniac, ein Fatalist, der mit der Schrotflinte durch die Straßen läuft. Einer, bei dem schon das unscheinbarste Wort zu einem Todesurteil wird. Im ersten Moment erschrak er, als er es so spielte - "Oh Gott, das ist auch in einem drin" -, aber dann hat es ihm wahnsinnig Spaß gemacht.
So eine Figur trägt Erceg auch ins Privatleben. Seine Frau merkt das schon, aber nicht nur deshalb findet er es schrecklich, Samstag und Sonntag bei einem Dreh frei zu haben. Das ständige Aus- und Einsteigen bei einer Rolle kostet ihn zu viel Energie.
image
Er liebt seinen Beruf. Liebt es, über ihn nachzudenken. Länger als drei Wochen zu verreisen empfindet er als vergeudete Zeit. Vielleicht, weil er nicht die Geduld, die Muße hat. Er braucht mindestens eine Inspiration am Tag. Und wenn er nur im Café sitzt und aus dem Fenster schaut, und da geht jemand vorbei und Erceg sieht eine Bewegung, eine Wendung des Kopfes und denkt: "Das ist ein interessanter Mensch." Das wäre eine Szene. In seinem Film. Denn Regie würde er ja auch gern führen, sagt er. Und sich selbst immerzu in Szene setzen. Er grinst. "Es gibt doch so viel, was man erzählen kann." Über Dinge, die einem in den Kopf fallen und die nicht mehr gehen wollen. Über diese Gesellschaft, in der du in das Raster passen musst und keine Schwäche zeigen darfst. "Das ist doch so wie bei den Hühnern in der Massentierhaltung", sagt Stipe Erceg. "Die fangen doch an, sich selbst zu fressen, sobald einer blutet." Ist er also ein politischer Mensch? "Ich bin nur auf Demos gegangen, wenn wir dafür schulfrei bekommen haben. Ich habe nicht die Illusion, dass ich etwas ändern kann. Nur mich." Und was soll bleiben von ihm am Ende, wenn es ums Loslassen geht? In Kroatien will er beerdigt werden, sagt er. In seiner Heimat, in seinem Dorf, im Familiengrab.
Der Stipe. Ernsthaftigkeit und Freundlichkeit sind die Tugenden, die er als Junge mit dem Deutschsein verband. Als er schon weg ist, fällt es einem wieder ein. So wie die Ruhe in seinen Bewegungen. Und dass er nicht gern ständig in Gesellschaft ist, wo man immerzu intelligent und witzig sein soll. Und dass er Gefühle mit sich selbst austrägt. "Denn so ist doch das Leben", hat er einmal gesagt, "wir können uns nicht erlauben, Gefühle zu zeigen, wir wollen sagen: Ich liebe dich, sagen aber: Ich liebe dich nicht."
Es existieren viele Arten von Wildheit, die äußere und jene innere, die keine Aufputschmittel braucht, sondern nur ein Ventil, weil sie sich sonst gegen einen selbst richtet. Nicht aufhören, auch wenn das Herz nicht mehr schlägt. In Stipe Ercegs Spiel sind das die guten Momente: wenn man sieht, wie das Eis bricht und das dunkle Wasser anschwillt und über die Ufer tritt.