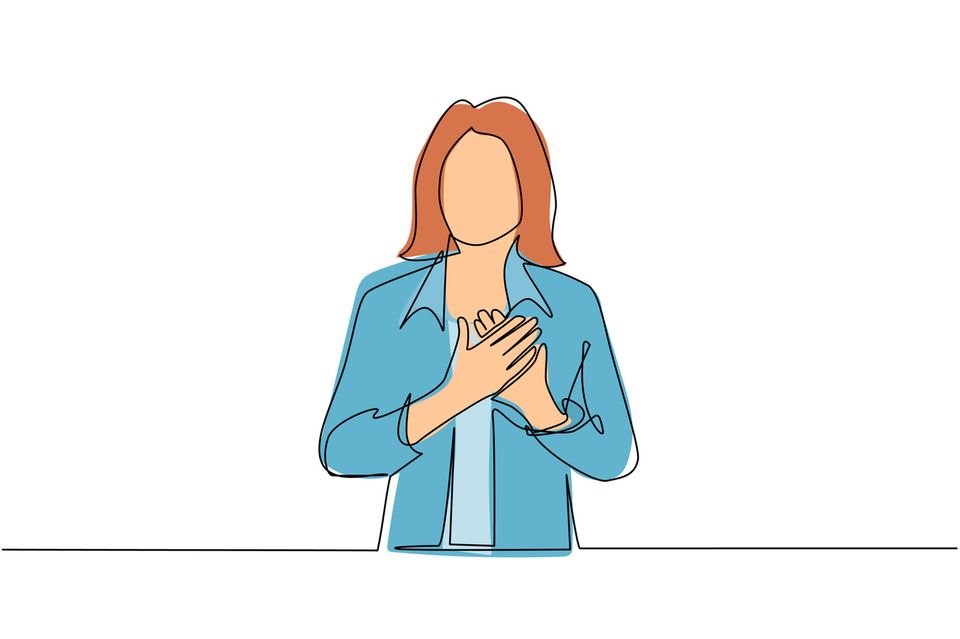Krankheiten als Gesprächsthema
Es ist ein bisschen wie eine Sucht, es ist ein schuldiges Vergnügen, wenn man einmal damit angefangen hat, kann man so leicht nicht wieder aufhören. Und es hört sich etwa so an, ein Tischgespräch mit drei, vier verteilten Rollen:
"Was hast du denn da am Arm?" "Da hab ich mich getapt. Wegen Tennis-Ellbogen." "Ich hab gehört, selbst Tapen bringt nichts. Also, bei mir hat es nicht gewirkt." "Simone hat es mir empfohlen, ich bilde mir ein, es hilft." "Bei mir hat nur Kortison geholfen." "Bei meinem Knie war das so ähnlich, da hat auch nichts mehr geholfen außer Rhus Tox." "Du musst zu diesem Physiotherapeuten gehen, wie heißt der noch gleich, da gehen die ganzen Theaterschauspieler hin." "Kortison darf ich nicht mehr, höchstens zwei Spritzen, sagt der Arzt." "Und wie lange hält das Tape?" "Matthias, heißt der. Irgendwas mit Matthias." Und so weiter, bis jemand sagt: "So, jetzt haben wir aber wirklich genug über Krankheiten geredet!"
Dann lachen alle ein wenig schuldbewusst und sprechen über ... irgendwas anderes. Aber über Krankheiten zu reden ist für viele erst mal unwiderstehlich.
Um was geht es, wenn wir über Krankheiten reden?
Es geht dabei nicht um Krebs und Aids, nicht um die wirklich schrecklichen Krankheiten, die letzten Dinge. Über die reden wir nicht in diesem Ton, nicht in dieser Ausführlichkeit, nicht so regelmäßig. Nicht mit so viel Lust und Hingabe. Es ist komisch: Die über ihre Krankheiten redenden Erwachsenen, das ist eigentlich ein Kindheitsbild, eine Erinnerung — Tante Ilse hat es jetzt auch im Knie. Die Großeltern berichteten an der Kaffeetafel in quälender Ausführlichkeit von ihren Chefarzt-Konsultationen in der Kurklinik, von Schlammpackungen und Schonkost, jeder hatte Rücken, jeder hatte es im Kreuz, an der Hüfte, in der Bandscheibe.
So alt zu werden, um so lange über so banale Dinge zu sprechen: Damals war das eigentlich unvorstellbar. Aber plötzlich fängt es an, ab Mitte, Ende 40, wenn die Verschleißerscheinungen mehr werden und mit ihnen die neuen Leiden: die Fersensporne, Tennisarme, Lendenwirbelblockaden, die Kopfschmerzen und das Ohrenpfeifen. Nichts Lebensbedrohliches, das ist ein anderes Thema. Bevorzugt Krankheiten, an denen man auf mittlerem Niveau lange leiden, gegen die man vieles ausprobieren und über die man möglichst ausführlich reden kann. Sind wir wirklich schon so alt? Fällt uns nichts Besseres mehr ein? Warum tun wir das, und ist es gut oder schadet es uns?
Gesprächsthema Nr. 1: Alltagskrankheiten
Eines kann man ganz klar festhalten: Über nichts reden Menschen lieber als über sich selbst. Je nach Erhebung verbringen sie etwa 60 bis 80 Prozent ihrer Sprechzeit damit, über sich selbst zu sprechen (unabhängig vom Geschlecht, übrigens). Und Hirnforscher der Universität Harvard haben vor einigen Jahren mithilfe der sogenannten bildgebenden Verfahren belegen können, was jeder immer schon geahnt beziehungsweise gespürt hat: Menschen reden gern über sich selbst, weil sich kaum etwas besser anfühlt. Denn dann werden im Gehirn die gleichen Regionen stimuliert, die aktiv werden, wenn Menschen gut essen, Drogen nehmen oder Sex haben. Und zwar ähnlich stark.
Warum reden wir so viel über unsere Wehwehchen?
Eine mögliche Erklärung ist also: Mit fortschreitendem Alter möchte man genauso gern über sich selbst reden wie früher, aber man hat aus den Bereichen Beruf, Liebe oder Freizeit eher weniger und über Krankheiten eher mehr zu erzählen. Um die 50 bietet das Thema ausreichend Gelegenheit, ausführlich von sich selbst zu erzählen. Übrigens ist es nicht schlecht, über sich selbst zu sprechen.
Der Kommunikationswissenschaftler Adrian F. Ward von der University of Texas schreibt im "Scientific American", dass auch das Reden über uns selbst eine soziale Funktion hat: "Persönliches zu enthüllen kann die zwischenmenschliche Zuneigung stärken und helfen, neue soziale Bindungen zu knüpfen." Die beiden Fersensporne im Freundeskreis kommen sich also über den Erfahrungsaustausch mit halbelastischen Kunststoffeinlagen näher. Außerdem, so Ward, führe das Sprechen über uns selbst "zu persönlichem Wachstum durch externes Feedback".
Also etwa: Du beklagst dich im Freundeskreis darüber, dass du nichts mehr erkennen kannst, weil Altersweitsichtigkeit, aber dass du keine Lesebrille tragen willst, weil Eitelkeit, und dann sagen alle, das sei doch völlig normal, Brille stehe dir bestimmt, und nichts sei, vom Sehen her, praktischer, als Dinge erkennen zu können. Das dann anzuerkennen wäre persönliches Wachstum durch Feedback auf die Schilderung der eigenen Gebrechen.
Wir bleiben auf der Sorgenebene hängen
Das Problem ist nur: Beim Reden über Krankheiten im Freundes- und Verwandtenkreis, am Kneipentisch oder bei der Familienfeier, findet bestenfalls eine Art Pseudo-Verarbeitung statt, sagt Gaby Bleichhardt von der Arbeitsgruppe Klinische Psychologie und Psychotherapie der Philipps-Universität Marburg. Sie legt Wert darauf, dass sie sich nicht auf spezielle Forschung oder Studien bezieht, sondern auf ihre klinische Erfahrung als Psychotherapeutin. Studien zum Thema gibt es nämlich nicht. Sie sagt: "Das Phänomen, dass Menschen gern im Freundeskreis über ihre Krankheiten reden, hängt damit zusammen, dass sie gern auf der sogenannten Sorgenebene hängenbleiben. Anders als etwa Ängste haben Sorgen eine eher moderate Verarbeitungstiefe, bei der man emotional weniger betroffen ist."
Reden über Sorgen gebe einem zwar das Gefühl, man beschäftige sich konstruktiv mit einem Problem, in der Regel sei das aber gar nicht der Fall, so Bleichhardt. Diese Art von Sprechen führe für denjenigen, der redet, lediglich zu einer momentanen Erleichterung oder "kleinen Befreiung", mehr nicht. "Eigentlich bewirkt sie, dass man Emotionen verdrängt." Und möglicherweise klagen wir ja auch darum so gern über eine Grippe oder einen Fersensporn, weil es leichter ist, als zu sagen, dass man sich mutlos und niedergeschlagen fühlt.
Manche Menschen profitieren allerdings darüber hinaus: diejenigen, die in besonderem Maß Angst vor Krankheiten haben "Für sie ist es schon sehr entlastend, von den eigenen Körpersymptomen zu erzählen. Hier wird nämlich der Gesprächspartner ohne sein Wissen getestet: Wenn er nicht gleich vom Tisch aufspringt und den Notarzt ruft, ist man vermutlich wirklich nicht lebensbedrohlich erkrankt und erst mal beruhigt. Suche nach Rückversicherung, nennen wir das."
Werden wir noch kränker, wenn wir über Krankheiten reden?
Kann das Reden über Krankheiten auch schaden? "Natürlich passiert dabei nichts Schlimmes, aber es führt zu nichts. Es ist verwandt mit dem Grübeln, bei dem man immer hin- und herüberlegt und in der eigenen Gedankenschleife festhängt. Im Gespräch über Krankheiten unter Freunden können einem die anderen vielleicht helfen, da wieder rauszukommen. Aber meist dreht man sich einfach gemeinsam im Kreis, und jeder wartet darauf, dass er wieder an der Reihe ist, um von sich zu erzählen."
Ist es aber nicht möglicherweise so etwas wie eine Übung, ein Warmlaufen für den Fall, dass wir traurigen Anlass haben, über wirklich ernste Krankheiten zu sprechen? "Nein", sagt Bleichhardt. „Wie gesagt: Eine wirkliche Verarbeitung von Ängsten findet nicht statt. Es läge ja nah, sich ab einem gewissen Alter mit engen Freunden über diese Ängste zu unterhalten, über die Wünsche für die eigene Beerdigung, über das Altersheim und die Pflege. Das macht aber beim Kneipenabend nicht so richtig Spaß."
Und so bleibt man eben lieber auf der Sorgenebene. Wenn man so will, sitzen wir also ums Lagerfeuer unserer gemeinsamen, unausgesprochenen Ängste, wenn wir über Krankheiten reden, die uns nicht umbringen werden, die uns aber beschäftigen. Die Tipps, die wir einander geben, werden uns nicht wirklich heilen.
Unsere eigenen Leidensgeschichten interessieren uns am meisten
Die Leidensgeschichten, die wir den anderen erzählen, interessieren uns nicht so sehr wie unsere eigenen. Aber wir sind Menschen, und wir sind zusammen, und wir reden. Wenn man sich so umschaut in der Gegenwart, dann ist das wohl schon ein Wert an sich. Und womöglich auch, dass wir ausnahmsweise in dieser durchorganisierten, effizienten Welt nicht über Stärke, Gewinnen und Bessersein reden, sondern über Schwäche und Schmerzen.
Und vielleicht ist dieses "Hängenbleiben auf der Sorgenebene" gar nicht so schlecht, wie es sich zunächst anhört: Ja, mag sein, dass das Reden über kleine und mittlere Leiden keine Besserung herbeiführt und dass wir uns in Wahrheit nur im Kreis drehen dabei. Aber insgeheim wissen wir das, und es dennoch zu tun heißt vielleicht auch, sich gegen Effizienz und Perfektionismus zu wehren: Wir wollen keine Lösung, wir wollen uns hauptsächlich selbst reden hören. Das ist nicht nur befreiend, sondern auf erfrischende Weise unproduktiv und menschlich.