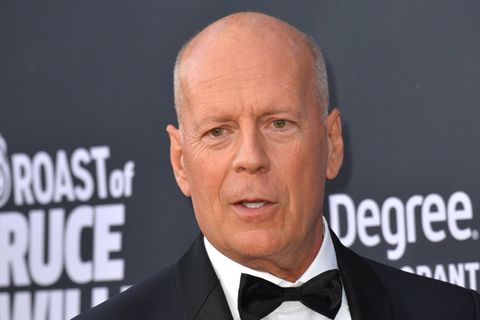Nur wenige Erkrankungen fürchten wir so sehr wie eine Demenz – und nur wenige halten die Medizin derart in Atem. Während beispielsweise viele Krebserkrankungen heutzutage gut behandelt werden können, ist die Suche nach Medikamenten gegen das große Vergessen eine lange Geschichte der Enttäuschungen. Ein Medikament, das Hoffnung machte, wurde zuletzt vor über 20 Jahren zugelassen. Memantin gehört mit Cholinesterasehemmern und Ginkgo bis heute zur Standardmedikation, doch alle drei Ansätze erzielen nur eine geringfügige Verbesserung für die Betroffenen.
Anfang 2023 dann ein Hoffnungsschimmer: Auf den US-amerikanischen Markt kommt ein neues Medikament, ein weiteres ist zur Zulassung eingereicht. Lecanemab, das bei uns vermutlich ebenfalls demnächst zugelassen wird, und Donanemab sind sogenannte Anti-Amyloid-Antikörper und verringern Eiweißablagerungen im Gehirn, die als mögliche Ursache der Erkrankung gelten. Personen mit Alzheimer, die Lecanemab nahmen, schnitten nach anderthalb Jahren Therapie bei Tests für Gedächtnis und Orientierung besser ab als jene in der Placebo-Gruppe. Der Erkrankungsverlauf sei um knapp ein Drittel gebremst worden, verkündeten die Hersteller.
Kleine Schritte auf dem Weg zum Ziel
Klingt gut, aber relativiert sich, wenn man die absoluten Zahlen betrachtet: Auf einer Skala von 0 bis 18 verbesserten sich die Beschwerden lediglich um einen halben Punkt. Der Krankheitsaufschub wird mit fünf bis sieben Monaten angegeben. Donanemab scheint zwar etwas besser zu wirken, aber immer noch zu wenig, findet Linda Thienpont, wissenschaftliche Leiterin der Alzheimer Forschung Initiative: "Für ein erfolgreiches Medikament sollten sich die Symptome deutlich verbessern und spürbar weniger werden. Das können auch die neuen Wirkstoffe nicht versprechen."
Also viel Lärm um nichts? Ganz so einfach ist es nicht; in der Behandlung von Alzheimer zählen auch kleine Schritte. Denn gerade weil die Ursachen für die Demenz nicht völlig geklärt sind, ähneln die Medikamente eher Versuchsballons als zielsicheren Durchbrüchen.
Alzheimer beginnt stumm.
Die meisten Forschenden nehmen zum Beispiel an, dass Eiweiße wie Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen – das sind Fasern im Zellinneren – Nervenzellen schädigen. Aber es scheinen auch Entzündungsreaktionen im Gehirn eine Rolle zu spielen. Worüber man sich in der Wissenschaft einig ist: Bisher setzen Medikamente schlicht zu spät im Prozess der Krankheit an. "Alzheimer beginnt stumm. Die Erkrankung zeigt sich erst 20 bis 30 Jahre, nachdem der Abbauprozess begonnen hat und viele der Nervenzellen bereits verloren gegangen sind", erklärt Linda Thienpont. Das Gehirn kann den Verlust sehr lange ausgleichen. Wird die Demenz durch Probleme mit dem Gedächtnis oder der Orientierung spürbar, sind die degenerativen Prozesse schon weit fortgeschritten und kein Medikament schafft es, tote Nervenzellen wieder lebendig zu machen.
Das Dilemma
Um eine Demenz zu verhindern, bevor sie ausbricht, braucht man also vor allem sensible Nachweismethoden. Durch Augenuntersuchungen, Biomarker im Hirnwasser und Blut oder mittels Immunzellen lässt sich Alzheimer inzwischen nahezu auf seine Anfänge zurückverfolgen – bis zur Marktreife hat es jedoch noch keiner der Tests gebracht.
Es könnte also sein, dass die neuen Medikamente durchaus besser wirken – aber eben nur in einem sehr frühen Stadium der Erkrankung. So früh, dass die Krankheit in der Regel noch gar nicht erkannt ist. Ein Dilemma.
Dazu kommt: Die Therapie mit den neuen Medikamenten ist gar nicht so leicht durchzuführen. Patientinnen und Patienten müssen engmaschig überwacht werden, da in sehr seltenen Fällen die Gefahr für Hirnschwellungen und Mikroblutungen besteht. Dafür eignen sich bildgebende Verfahren mittels MRT – auf Dauer eine kostspielige Angelegenheit. Außerdem muss das Medikament alle paar Wochen gespritzt werden.
Die Suche geht also weiter
Der deutsche Verband der forschenden Arzneimittelunternehmen listet aktuell 24 Mittel auf, die an Betroffenen getestet werden. Neben weiteren Amyloid-Antikörpern auch neue Ansätze, etwa solche, die die Signalübertragung zwischen Nervenzellen verbessern oder den Energiestoffwechsel der Zellen steigern. "Der genaue Ablauf der Zerstörung im Gehirn ist offenbar etwas sehr Individuelles", sagt Linda Thienpont. "Wir brauchen deshalb Kombinationstherapien, die individuell auf die Betroffenen zugeschnitten sind. Dafür werden die Antikörper bestimmt von Nutzen sein, aber sie sind kein Allheilmittel."
Eine große Chance liegt aber auch in der Prävention. Studien zeigen, dass in einigen Industrieländern die Rate der Neuerkrankungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten abgenommen hat. Das könnte den besseren Lebensbedingungen und dem gesünderen Altern zuzuschreiben sein, etwa weil bekannte Risiken wie Diabetes oder Bluthochdruck vermieden oder konsequent behandelt werden. Linda Thienpont ist zuversichtlich: "Allein durch unseren Lebensstil können wir das Risiko für Alzheimer um bis zu 40 Prozent verringern."