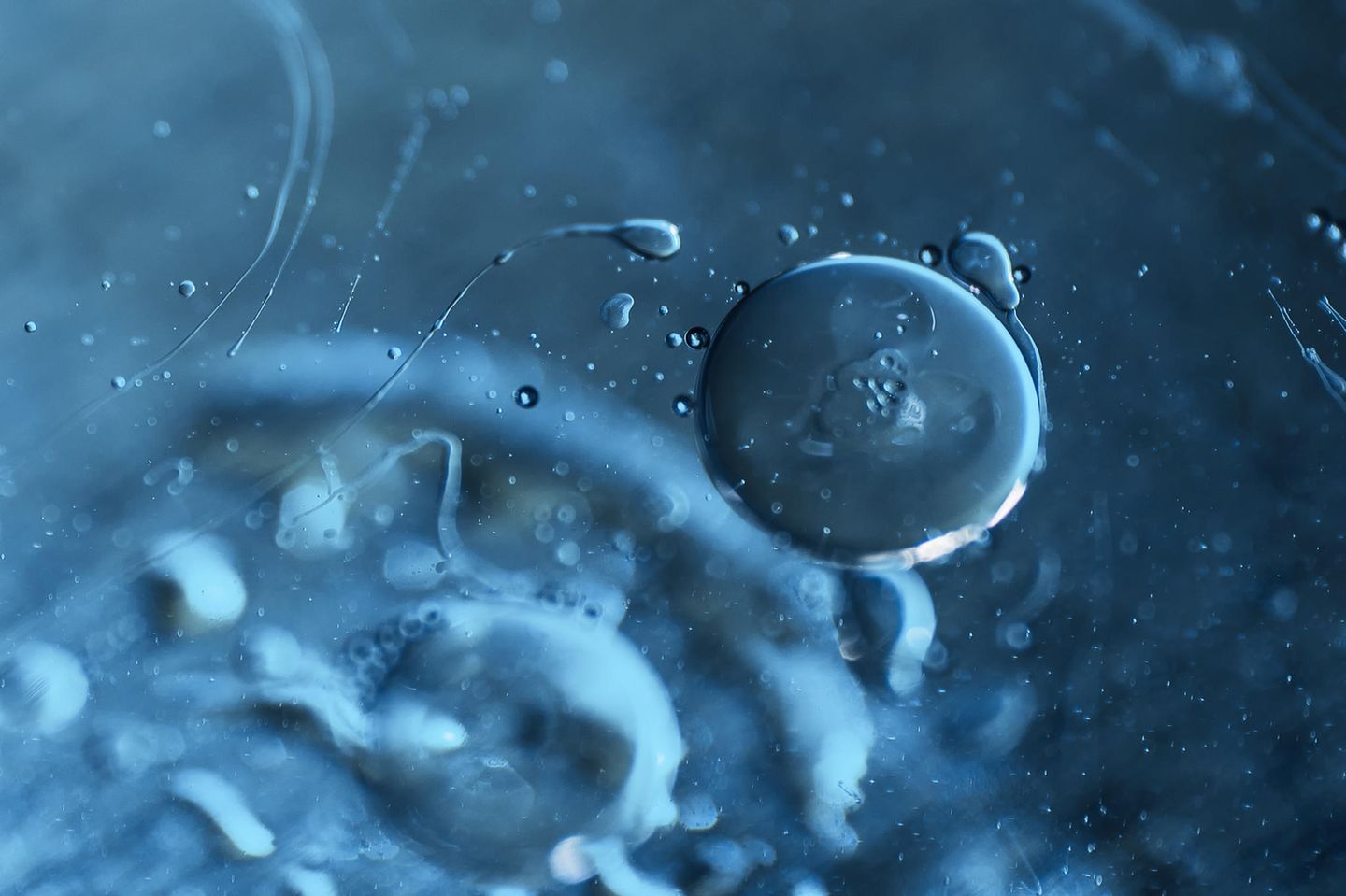Der Blick geht weit, wenn Melina Schuh an ihrem Schreibtisch sitzt, durch die großen Fenster, über Grün und Baumwipfel den Hang hinunter. Das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie liegt etwas außerhalb von Göttingen. Verschachtelte Gebäude, Zufahrten auf verschiedenen Ebenen, eine eigene sehr komplexe Siedlung – und seit fast 50 Jahren ein Ort internationaler Spitzenforschung.
"Es ist für mich ein großes Geschenk, in so einem Umfeld – unter anderem mit Stefan Heil, der 2014 den Nobelpreis bekommen hat – und mit so vielen Freiheiten und Möglichkeiten arbeiten zu können", sagt Melina Schuh, seit vier Jahren eine der Direktor*innen hier und ebenfalls preisgekrönt: Im vergangenen Jahr zum Beispiel gewann sie den wichtigsten deutschen Forschungsförderpreis, den mit 2,5 Millionen Euro dotierten Leibniz-Preis.
Prozesse sichtbar machen
Die 40-Jährige hat Dinge gesehen, die vor ihr nie ein Mensch beobachtet hat. Und zwar auf einem Forschungsgebiet, das das genaue Gegenteil zum Fernblick aus ihrem Büro ist: Melina Schuh sieht ins Innerste, ins Kleinste, dahin, wo alles anfängt: in die Eizelle. "Ihre Entstehung steht am Beginn jeden Lebens", sagt sie. "Aber über das, was da genau passiert, wissen wir bisher ziemlich wenig – vor allem beim Menschen." Um dies zu ändern, beobachten sie und ihr Team von 16 Wissenschaftler*innen aus über zehn Nationen die Zellen mit Hochleistungsmikroskopen zum Preis eines Einfamilienhauses, vor allem bei der sogenannten Reifeteilung oder Meiose. Dabei wird der doppelte Chromosomensatz, den jede unserer Körperzellen besitzt, halbiert, damit später nach der Befruchtung, wenn Ei- und Samenzelle verschmolzen sind, das Genmaterial wieder vollzählig ist.
Mikroskope faszinierten Melina Schuh bereits als Kind; ihr Vater sammelte antike Modelle. Aber nicht nur diese Begeisterung erklärt ihre Forschungserfolge. Mindestens genauso wichtig: Kreativität, Beharrlichkeit, Frustrationstoleranz und jede Menge Geduld. Wer sich mit ihr unterhält, spürt schnell, dass Melina Schuh eine sehr angenehme Art hat, beides zugleich zu sein: entspannt und fokussiert.
Genau deshalb hat sie auch ein Händchen für ihre Versuchsobjekte. Denn: "Eizellen sind Sensibelchen." Unzählige Fehlversuche brauchte es, die Prozesse in ihrem Inneren sichtbar zu machen: das Aufbrechen des Zellkerns, das Sortieren der mit fluoreszierenden Proteinen markierten Chromosomen, die Bildung der sogenannten Spindel, die diese auseinanderzieht.
Melina Schuh wird den Moment nicht vergessen, als sie – damals Doktorandin in Heidelberg – erstmals mit der Zelle einer Maus davon Zeuge wurde: "Ich saß abends noch allein vor dem Mikroskop, es war draußen schon dunkel, und dachte: Du bist der erste Mensch, der das im Detail beobachten darf." Später gelang ihr mit ihrer Arbeitsgruppe in Cambridge dann der nächste Schritt hin zu menschlichen Eizellen. Die sind in der Meiose sogar noch empfindlicher, weil sie – keiner weiß bisher warum – dafür länger brauchen als alle anderen Säugetiere, nämlich etwa 24 Stunden und zudem nur sehr begrenzt verfügbar sind.
Der Beginn des Lebens
Sowohl in England als auch jetzt in Deutschland arbeitet Melina Schuh dafür mit Kinderwunschzentren zusammen. Ab und zu überlassen ihr Frauen, die dort behandelt werden, überzählige, unbefruchtete Eizellen, die sonst verworfen würden. "Aber niemand weiß wann", sagt Melina Schuh. "Dann kommt morgens ein Anruf, und einer von uns fährt mit einem Mini-Inkubator hin, um die Zelle abzuholen." Zurück im Labor muss dann alles sehr schnell gehen, sonst ist die Meiose bereits zu weit fortgeschritten.
Was Melina Schuh betreibt, ist Grundlagenforschung und erst mal nicht auf unmittelbare praktische Anwendung ausgerichtet. Aber sie berührt einen Bereich, der für viele Frauen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch von entscheidender Bedeutung ist. Im letzten Jahr hat die Forscherin mit einer Kollegin gefordert, man müsse neu über den Beginn des Lebens diskutieren. Hintergrund waren Erkenntnisse, wie lange es dauert, bis nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle auch die Chromosomen von Mutter und Vater gemischt werden. "Juristisch gilt genau dies in Deutschland als Beginn des Lebens. Aber offensichtlich wissen wir gar nicht, wann das wirklich stattfindet", sagt Melina Schuh.
Trotzdem hat die Rechtslage weitreichende Konsequenzen, denn bei uns müssen deshalb Embryonen für die Kinderwunschbehandlung schon in einem sehr frühen Stadium ausgewählt werden. Das senkt die Erfolgschancen und führt dazu, dass oft gleich mehrere Embryonen eingesetzt werden. Mit Mehrlingsschwangerschaften aber steigen die Gefahren für Mutter und Kind(er). In anderen Ländern wird dagegen abgewartet, welcher Embryo sich überhaupt oder am besten entwickelt. "Natürlich können wir nicht nach jeder Studie den Beginn des Lebens verlegen", sagt Melina Schuh, "aber die neuen Erkenntnisse sollten wir zum Anlass nehmen, unsere sehr vage Definition zu überdenken und zu ändern – zum Benefit der Frauen."
Wie genau altern Eizellen?
Menschen mit Kinderwunsch zu helfen, daraus zieht die Forscherin immer wieder Motivation: "Als ich 30 wurde, habe ich in meinem Freundeskreis mitbekommen, dass es nicht immer so schnell klappt mit einer Schwangerschaft. Wir wollen verstehen, warum die Qualität der Eizellen mit dem Alter abnimmt. Denn nur dann lässt sich gegensteuern. Es ist bereichernd, dazu beitragen zu können, dass Frauen mit Unfruchtbarkeit vielleicht irgendwann besser geholfen werden kann."
Aber wie genau altern nun Eizellen? "In jeder Zelle haben wir zwei Kopien eines Chromosoms – eins von der Mutter, eins vom Vater", erklärt Melina Schuh. "Damit diese in der Reifeteilung korrekt voneinander getrennt werden, liegen sie als Paar nebeneinander. Und zwar schon, seitdem die Eizellen im Embryo angelegt wurden. Allerdings beginnen die Paare mit der Zeit auseinanderzufallen." Die Chromosomen rutschen also schon auseinander, bevor sie richtig getrennt werden. Außerdem werden unter anderem die Strukturen, die die Chromosomen auseinanderziehen, instabiler.
Und so passiert es mit zunehmendem Alter immer häufiger, dass das genetische Material nicht korrekt halbiert wird, sondern Sortierfehler unterlaufen. Die weibliche Fruchtbarkeit sinkt, weil die meisten von ihnen nicht überlebensfähig sind. Das Downsyndrom ist eine der sehr wenigen Ausnahmen. "Schon um die 20 liegt der Anteil fehlerhafter Eizellen zwischen zehn und 15 Prozent", sagt Melina Schuh und klingt dabei selbst ein bisschen erstaunt, wie viel Unordnung sich die Natur in diesem wichtigen Prozess leistet.
Ob sich das Altern der Eizellen irgendwann ganz abstellen lässt, da ist die Forscherin skeptisch: "Aber es zu entschleunigen, wäre ja schon mal ein wichtiger Schritt." Gleichzeitig sieht sie den Machbarkeitsglauben der Reproduktionsmedizin kritisch: "In den Medien wird oft über Frauen, häufig Prominente, berichtet, die mit über 50 schwanger werden. Dadurch wird suggeriert, dass Mutterschaft quasi jederzeit möglich ist. Aber das ist falsch: In vielen Fällen kommen diese Babys per Eizellspende auf die Welt. Die Chance, ab Mitte 40 ein Kind zu bekommen, ist gering – auch mittels In-vitro-Fertilisation."
Sie selbst hat sich beeilt mit der Familienplanung. "Das war auf jeden Fall ein Effekt meiner Forschung", sagt sie lachend. Mit 32 wurde Melina Schuh das erste Mal Mutter, inzwischen hat sie vier Kinder zwischen sieben und eins. "Es ist eine sehr positive Entwicklung, dass die Medizin so vielen Paaren den Kinderwunsch erfüllen kann", sagt die Forscherin. "Aber es gibt ein Limit und wird es auch immer geben. Das sollten wir uns bewusst machen – auch wenn es, vielleicht gerade weil die Vorgänge in der Zelle so komplex sind, schwerfällt, es zu akzeptieren."
Die Entstehung des Menschen – ein Wunder
Die eigenen Eizellen frühzeitig einzufrieren, lässt die biologische Uhr seit ein paar Jahren allerdings zumindest langsamer ticken. "Grundsätzlich finde ich das positiv", sagt Melina Schuh. "Aber es rein prophylaktisch in jüngeren Jahren zu tun, halte ich nicht für sinnvoll. Man sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen. Es gibt keine Garantie, dass das, was da im Freezer lagert, einer Frau später wirklich zu einer Schwangerschaft verhilft." Sie selbst arbeitet deshalb bisher meist nur mit frischen, unbefruchteten Eizellen: "Wir schauen uns gerade erst an, wie sich die Zellen nach dem Auftauen verhalten. Das ist allerdings technisch wieder nicht so einfach."
Man spürt Melina Schuhs Ehrgeiz und ihre Neugier, immer tiefer einzudringen, immer mehr zu verstehen. Und gleichzeitig immer mehr zu staunen: "Je mehr ich weiß, desto mehr Respekt habe ich. Es ist erstaunlich, wie viele Prozesse ineinandergreifen müssen, damit etwas so Komplexes wie der Mensch entstehen kann." Sie hält kurz inne: "Eigentlich kaum zu glauben, dass es überhaupt funktioniert. Ein Wunder!"
Holt euch die BRIGITTE als Abo – mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.