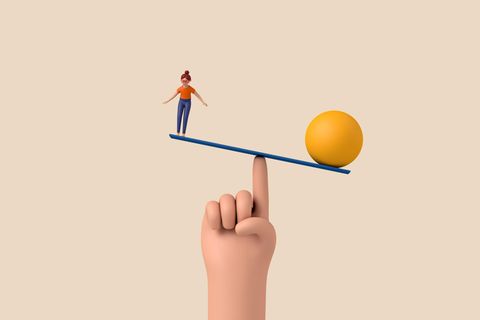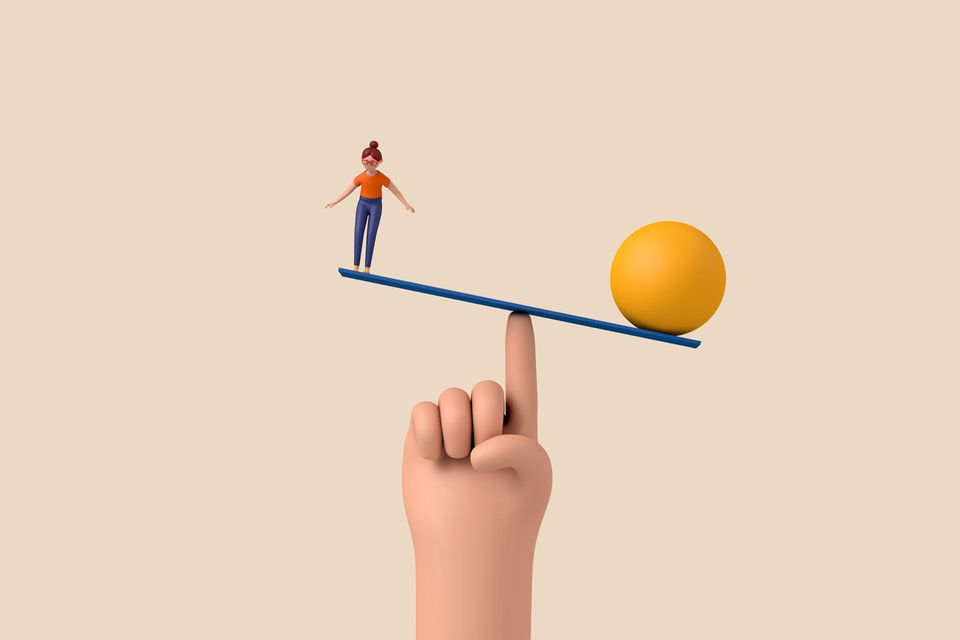Die Sache hatte sich ziemlich schnell von selbst erledigt. Laurel Hubbard schaffte beim Gewichtheben in der Klasse über 87 Kilogramm keinen gültigen Versuch und schied deswegen im vergangenen Sommer in Tokio frühzeitig aus.
Vorher allerdings machte die Teilnahme der Neuseeländerin Schlagzeilen. Denn Laurel Hubbard ist die erste Trans-Sportlerin, die offen als solche bei Olympischen Spielen startete. Was die einen als Zeichen einer neuen Zeit bejubelten, hielten andere schlicht für unfair. Auch wenn Hubbards Testosteronwerte seit Längerem niedrig sind – sonst dürfte sie auch gar nicht bei den Frauen starten –, hatte ihr Körper schließlich die längste Zeit ihres Lebens unter dem Einfluss dieses natürlichen Dopingmittels gestanden. Sein Einfluss auf Athletik, Kraft, Ausdauer oder Schnelligkeit ist groß und teilweise von Dauer. Hatte Laurel Hubbard also hormonell bedingt einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrentinnen? Würde man am Ende nicht nur ihr, sondern vor allem einem Hormon die Medaille um den Hals hängen? Eine Antwort erübrigte sich dann, wie gesagt, durch Hubbards drei Fehlversuche.
Hormone: die Dirigenten unseres Lebens
Trotzdem: Da standen sie mal wieder im Rampenlicht, die Dirigenten unseres Lebens, wie Hormone manchmal genannt werden. Etwa 150 von ihnen gibt es in unserem Körper. Darunter so prominente wie das Insulin, das den Blutzuckerspiegel reguliert, oder das Stresshormon Cortisol. Das emotionalste und ambivalenteste Verhältnis haben wir aber sicher zu den sogenannten Geschlechtshormonen. Denn sie formen unseren Körper, beeinflussen die Pubertät, die Frage, ob wir Kinder bekommen, die Wechseljahre – und damit wesentlichere Aspekte unseres Frauseins als, sorry Insulin, der Blutzuckerspiegel.
Wie sehr weibliche und männliche Hormone unser Leben bestimmen, kann auch die Wissenschaft oft nicht eindeutig beantworten. Das Bild, das wir als Gesellschaft von ihnen zeichnen, bietet deswegen Raum für Interpretation und dreht sich immer auch um die Frage, wie viel Macht wir ihnen gerade zuschreiben oder zugestehen wollen. Das zeigen die Auseinandersetzungen um Laurel Hubbard, aber auch andere aktuelle Entwicklungen. Wenn vor allem junge Frauen einen "Menstruationsurlaub", also bezahlte freie Tage während der Regelblutung, fordern, geht es schließlich ebenfalls um Hormone und darum, was ihr zyklisches Auf und Ab mit uns macht.
Aber mal davon abgesehen, dass jede, die sich schlecht fühlt – egal weshalb –, nicht zur Arbeit erscheinen dürfen sollte, ohne schief angesehen zu werden: Wollen wir das eigentlich? Frauen als hilflosen Spielball der Hormone begreifen? Unter dieser männlichen Sichtweise haben wir schließlich lange gelitten: sie, ihrer Biologie unterworfen, er, eine Stufe über ihr in geistigen Höhen. Um einen Mittelweg müssen wir vermutlich immer wieder ringen: Ja, die Hormone beeinflussen uns (und Männer natürlich auch!), aber wir sind trotzdem Herrin unserer selbst.
Hormone geben uns aber auch Freiheit
Übrigens haben uns Hormone in diesem Sinne auch viel Macht gegeben – wenn auch nicht unsere körpereigenen –, und hier wird es erneut emotional. "Die Pille hat die sexuelle Befreiung der Frau überhaupt erst möglich gemacht", sagt Dr. Katrin Schaudig, Gynäkologin aus Hamburg und Präsidentin der Deutschen Menopause Gesellschaft. "Die Hormone haben dazu geführt, dass wir ohne Angst vor einer Schwangerschaft Sex haben können. Wir verdanken ihnen eine sehr segensreiche Entwicklung." Die Spezialistin für Hormonstörungen wundert sich deswegen, dass inzwischen immer mehr ihrer Patientinnen die Pille ablehnen mit der Begründung, sie wollten sich nicht fremdbestimmen lassen. Natürlich müsse man Nebenwirkungen ernst nehmen, sagt Katrin Schaudig, aber mittlerweile höre sie häufiger von Frauen, die die Pille zwar gut vertragen, doch sich anderen gegenüber nicht trauen zu sagen, dass sie sie nehmen, aus Angst, abgelehnt oder verurteilt zu werden. Pillen-Scham sozusagen: "Hormone werden zu sehr in die Ecke gestellt, als seien sie unnatürliches Gift für den Körper. Und das nervt mich."
Noch dramatischer findet die Ärztin diesen Trend in den Wechseljahren: "Selbst Frauen mit einem hohen Leidensdruck haben Angst vor Hormonpräparaten, als wäre es ein Versagen, sie zu nehmen. Aussagen wie ‚Das muss ich doch allein schaffen‘ begegnen mir immer öfter. Ich finde das ein sehr spannendes Thema: Warum wird die Anwendung von Hormonen von der Gesellschaft zurzeit mit einem Schuldgefühl belegt?"
Sicher spielt dafür auch der Mega-Trend "Zurück zur Natur" eine Rolle, aber unsere eigene Natur ist eben auch nicht immer gut zu uns. Die Wechseljahre können eine Qual sein. Warum sollte man ein schlechtes Gewissen haben, dann hormonelle Unterstützung zu nutzen? "Ich würde mir wünschen, dass wir die Ideologie aus diesen Fragen heraushalten und Frauen stattdessen neutral und wissenschaftlich fundiert informieren", sagt Katrin Schaudig.
Laurel Hubbard hat dann übrigens doch noch gewonnen. Von der University of Otaga in ihrer Heimat Neuseeland wurde die 43-Jährige im Oktober zur Sportlerin des Jahres gewählt. Hormone hatten dabei eindeutig nicht ihre Finger im Spiel.
Wie sie nützen, wie sie nerven
Pubertät, Sexualität, Menopause – Östrogene & Co. bestimmen viele Aspekte unseres Lebens. Die wichtigsten Fragen:
1. Prägen uns Östrogen und Testosteron schon vor der Geburt?
Natürlich vor allem, was die Ausbildung der Geschlechtsorgane angeht. Bei einem Individuum mit zwei X-Chromosomen ist diese zwar hormonunabhängig, aber dass ein Embryo mit einem Y-Chromosom sich äußerlich und innerlich männlich entwickelt, liegt vor allem am Testosteron. Doch wächst Jungs im Bauch der Mutter unter dem Einfluss dieses Hormons genauso wie Hoden und Penis auch ein männliches Hirn?
Fest steht, dass sich das Gehirn später entwickelt als die Geschlechtsorgane: Während das Testosterongefälle zwischen den Geschlechtern im mütterlichen Bauch erst sehr groß ist, sodass die Embryos in den meisten Fällen körperlich eindeutig zu Jungen bzw. Mädchen werden, nähert es sich, wenn sich das Gehirn entwickelt, schon wieder an. Also: Nix mit Mars und Venus, so unterschiedlich ist der Hormoncocktail während dieser Schwangerschaftsphase im Durchschnitt gar nicht. Es gibt sogar einen Überlappungsbereich, das heißt, bei einem Teil der Ungeborenen – egal ob Junge oder Mädchen – erfolgt die Hirnentwicklung unter ähnlichen hormonellen Verhältnissen.
Wie diese ausgesehen haben, darüber geben zeitlebens unsere Hände Auskunft: Denn auch das Fingerlängenwachstum wird durch Sexualhormone geprägt und zwar genau dann, wenn sich das Gehirn entwickelt. Hier eine Auswahl, was alles mit einem längeren Ringfinger im Verhältnis zum Zeigefinger und also viel vorgeburtlichem Testosteron zusammenhängt:
- Durchsetzungskraft
- räumliches Vorstellungsvermögen
- Aggressivität
- Wettbewerbsstreben
- Risikobereitschaft
- Suchtverhalten
- Sportlichkeit
- Untreue
Wem das zu sehr nach Klischee klingt, den wird beruhigen, dass die Fingerlängenforschung durchaus kritisiert wird, etwa weil es nicht mal einheitliche Messmethoden gibt. Und: Auch wenn sich alle gern auf die Unterschiede von weiblichen und männlichen Hirnen stürzen, sind die Übereinstimmungen größer. Außerdem werden sie viel stärker davon geprägt, was nach der Geburt passiert: unseren Erfahrungen.
2. Beginnt die Pubertät immer früher?
Vor allem weil sich der Ernährungsstatus verbesserte und Kinder durch Fortschritte in Hygiene und Medizin seltener krank wurden, begann das Alter der ersten Regelblutung vor etwa 150 Jahren zu sinken, von durchschnittlich 16 bis 17 auf nunmehr gut 12 Jahre. Allerdings verändert sich daran seit etwa zwei Jahrzehnten kaum noch etwas. So wie bei der Körpergröße scheint ein biologisches Limit erreicht. Doch die Pubertät ist eine Phase und das Einsetzen der Menstruation fast ihr letzter Schritt. Den Beginn markiert ein paar Jahre zuvor die Brustentwicklung und hier tut sich tatsächlich noch etwas. Eine dänische Studie konnte nachweisen, dass innerhalb eines Zeitraums von nur 15 Jahren Mädchen ein ganzes Jahr früher einen Busen bekamen, nämlich bereits ein paar Monate vor ihrem zehnten Geburtstag, auch wenn die Regel weiterhin zur etwa gleichen Zeit einsetzte. Eine große Metaanalyse belegte dies als weltweiten Trend.
Woran das liegt? Teilweise daran, dass Übergewicht bei Kindern zunimmt. Erst ab einem Körperfettanteil von 17 Prozent gibt das im Fettgewebe produzierte Hormon Leptin dem Gehirn den Startschuss zur Pubertät. Leichtgewichtige Leistungssportlerinnen mit wenig Fett- und viel Muskelmasse kommen deswegen später in die Pubertät, Kinder mit einem hohen Body-Mass-Index (BMI) entsprechend früher. Aber auch Stress ist ein Beschleuniger, genauso wie das Aufwachsen in der Stadt. Ein weiterer Faktor sind vermutlich Chemikalien. Übrigens: Trotz der schnelleren körperlichen Reife lassen sich Jugendliche heute eher Zeit. Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung geben deutlich weniger der 14- bis 16-Jährigen an, bereits sexuelle Erfahrungen gemacht zu haben als vor zehn Jahren.
3. Kommt hormonelle Verhütung aus der Mode?
Laut einer Umfrage liegt sie zusammen mit dem Kondom mit 47 bzw. 46 Prozent Anwender:innenanteil weiterhin fast gleichauf auf Platz eins der Verhütungsmethoden. Doch der Trend ist eindeutig: Gegenüber der Erhebung sieben Jahre zuvor ging die Zahl der Nutzerinnen um sechs Prozentpunkte zurück, bei den 18- bis 29-Jährigen um 16 Prozent. Denn inzwischen wird mehr über die Verträglichkeit der Pille gesprochen. Nicht nur über das erhöhte Thromboserisiko, sondern auch über Libidoverlust, Stimmungsschwankungen oder Depressionen, vor allem in den sozialen Medien, wo Influencerinnen wie Dagi Bee öffentlich der Pille abschwören.
Laut der Umfrage "New Insights into Contraception" ist für sechs von zehn Nutzerinnen die Pille trotzdem weiterhin alternativlos, denn neben der Verträglichkeit zählen für viele eben auch hohe Sicherheit und einfache Anwendung. Wichtig in Sachen Nebenwirkungen: Pille ist nicht gleich Pille. "Welche die richtige ist, muss immer individuell entschieden werden", sagt Frauenärztin Katrin Schaudig.
4. Gibt es das "Period Brain" wirklich?
Dass Frauen irgendwie seltsam im Kopf werden, wenn sie ihre Tage haben, meinten schon die alten Griechen. Inzwischen scheinen viele Studien das zu belegen – und werden von den Medien immer wieder gern aufgegriffen: Die Geschichte, dass Frauenhirne Opfer der Hormone sind, zieht eben auch heute noch. Das räumliche Vorstellungsvermögen etwa ist in der ersten Zyklushälfte am höchsten, dann können wir uns auch Dinge besser merken; wortgewandter sind wir dagegen nach dem Eisprung. Allerdings sind die Stichproben solcher Studien meist klein und die Ergebnisse lassen sich oft nicht replizieren.
Ein Team der Uni Zürich wollte es genau wissen und untersuchte immerhin 88 bzw. 68 Frauen über zwei Zyklen hinweg. Eindeutiges Ergebnis: nichts. Keiner der zahlreichen kognitiven Tests zeigte irgendeinen Zusammenhang mit den Hormonen. Das "Period Brain" existiert laut Studienleiterin Brigitte Leeners vielleicht im Einzelfall, aber nicht generell.
Einen Effekt auf unser Gehirn haben Östrogene trotzdem. So verhindern sie etwa Eiweißablagerungen in den Nervenzellen, mit denen eine Demenzerkrankung beginnt. Dieser Schutz fällt mit den Wechseljahren recht abrupt weg. Vermutlich ein Grund, warum Frauen häufiger dement werden als Männer.
5. Was macht Testosteron im weiblichen Körper?
Wie man heute weiß, nicht nur Ärger (Akne, Damenbärte), sondern auch viel Positives, vor allem für Muskeln und Libido und möglicherweise auch für die Stimmung. Testosteron macht Frauen egoistischer, sie beharren eher auf ihrer eigenen Meinung. Man kann es also als Gegenpol zum Östrogen betrachten, das uns willens macht, uns um andere zu kümmern. Weil es für erfüllenden Sex nicht hilfreich ist, vor allem an den anderen zu denken, ist Testosteron eine Idee bei Libidostörungen. Zumindest profitieren Frauen, die ihre Eierstöcke (und damit ihre Testosteronfabriken) früh verloren haben, etwa wegen Krebs. Aber gilt das auch für Frauen in ihren natürlichen Wechseljahren? Denn ob Lust da ist oder nicht, hat eben nicht nur mit einem Hormon zu tun, es hängt von der Beziehung ab, davon, wie sehr mich mein Partner langweilt, wie viel Raum ich Sex geben kann und will etc.
Außerdem sind die Testosteron-Präparate, die es in Deutschland zurzeit gibt, alle nicht für Frauen zugelassen und zu hoch dosiert. Man kann zwar Testosteron-Gel in der Apotheke herstellen lassen, aber Vorsicht: Bei Überdosierung drohen starke Behaarung, Stimmveränderungen und andere Gemeinheiten.
6. Wann im Zyklus trainiert man am effektivsten?
Grundsätzlich kann man sagen: Östrogen erleichtert den Muskelaufbau und steigert die Trainingsleistung, weil es eine erregende Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat. Progesteron dagegen hemmt es und fährt uns eher runter. Ideal ist es daher für unsere körperliche Leistung, wenn der Östrogenspiegel hoch und der Progesteronspiegel niedrig sind – also in der Zeit nach der Blutung bis zum Eisprung. Dann kann man optimal trainieren: lange und mit hoher Belastung. Zumindest theoretisch.
In der Praxis konnte dies nämlich bisher nicht klar belegt werden. Eine britische Metaanalyse zur Kraft während des Menstruationszyklus zum Beispiel fand keine signifikanten Unterschiede. Eine der Forschenden, die Sportwissenschaftlerin Dr. Georgie Bruinvels, glaubt, dass das Thema eben sehr individuell ist. Ihrer Erfahrung nach fühlen sich viele während der Blutung unwohl, was sich auch auf Leistung und Bewegungsverhalten auswirkt. Trotzdem rät sie zu Bewegung, denn "Sport kann die psychologischen und körperlichen Symptome im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus dauerhaft verbessern". Der wichtigste Tipp: gut auf den eigenen Körper zu hören, was sich gerade gut anfühlt.
7. Ist unsere Laune ein Spielball der Hormone?
Einerseits, andererseits. Fest steht, dass Progesteron für Entspannung und Gelassenheit sorgt: Weil es auch an den Cortisolrezeptor andockt, und wenn es dort sitzt, kann das Stresshormon nichts mehr bewirken. Wenn Progesteron vor der Monatsblutung abfällt, kann das ein Grund sein für Gereiztheit und schlechte Laune, also das Prämenstruelle Syndrom PMS. Und Östrogene gelten generell als stimmungsaufhellend, sie sind um den Eisprung herum am höchsten konzentriert.
Es scheint allerdings komplizierter zu sein. So weiß man: Wenn nach einer Geburt der Östrogenspiegel abrupt abfällt, ist zeitgleich ein Enzym besonders aktiv, das das Glückshormon Serotonin abbaut. Es könnten also die Schwankungen sein, die neben den Wochenbettdepressionen auch die Stimmungstiefs in den Wechseljahren erklären. Aber: Die Wechseljahre fallen üblicherweise in eine Lebensphase, in der es oft ohnehin ernst zugeht: Die Kinder sind größer, aber die Sorgen um sie nicht unbedingt kleiner, gleichzeitig brauchen die eigenen Eltern oft mehr Unterstützung.
Dazu die Gewissheit, dass die Kraft nachlässt und es Zeit ist, Dinge im Leben zu ändern, wenn man es später nicht bereuen will. Da kann es auch sehr angemessen sein, traurig zu werden oder schlecht drauf zu kommen, vollkommen unabhängig von der hormonellen Lage.
8. Wie beeinflussen Hormone unsere Abwehr?
Grob kann man sagen, dass Testosteron unser Immunsystem dämpft und Östrogene es stimulieren. Das hat Vor- und Nachteile: Frauen sind weniger infektanfällig als Männer, aber neigen eher zu Überreaktionen – rund 80 Prozent der Autoimmunerkrankten sind weiblich. Nach einer Impfung bilden Frauen laut einer Studie mehr Antikörper, aber zeigen auch mehr Nebenwirkungen. Fast 70 Prozent der Meldungen zu unerwünschten Folgen der Corona-Impfung bei der Arzneimittelbehörde Swissmedic stammen von Frauen.
Auch das Auf und Ab der Hormone nimmt Einfluss: In der ersten Zyklushälfte sind die T-Lymphozyten eher auf Angriff gepolt, in der zweiten auf Toleranz – es könnte schließlich sein, dass die Eizelle befruchtet wurde und ein "Fremdkörper" geduldet werden muss. Heißt umgekehrt: Wir fangen uns eher mal was ein. Auch werdende Mütter sind deswegen infektanfälliger. Grippe- und Corona-Erkrankungen etwa verlaufen dann heftiger. Die Immun-Dimmung kann aber auch Vorteile haben: Frauen mit rheumatischen Erkrankungen oder einer Multiple Sklerose geht es oft besser, während sie schwanger sind.
Mit den Wechseljahren büßen wir dann leider alle einiges an hormonellem Immunschutz ein. Das gilt auch in Bezug auf Covid-19: Eine Analyse des King’s College kommt zu dem Schluss, dass der gesunkene Östrogenspiegel Frauen in der Postmenopause anfälliger macht für einen schweren Verlauf. Wer Hormonersatzpräparate nimmt, erkrankt dagegen meist milder. Das Gleiche gilt für jüngere Frauen, die mit der Pille verhüten. Sollten wir also Hormone schlucken, um die Abwehr zu stärken? Sicherlich nicht, denn die können eben auch unerwünschte Nebenwirkungen haben (siehe Fragen 3 und 13).
9. Welche Rolle spielen Östrogene für den Sex?
Sie sind für vieles verantwortlich, was wir mit Weiblichkeit in Verbindung bringen: für unsere Rundungen – nein, sie machen nicht dick, aber sorgen für die typisch weibliche Fettverteilung an Po und Hüfte – und zusammen mit Progesteron für unseren Zyklus. Aber für das Sexualverhalten spielen sie eine vergleichsweise kleine Rolle. Zwar gibt es mehr Sexualkontakte in der Zeit um die Ovulation, wenn der Körper von Östrogen geflutet ist.
Diesen Peak flacht die Pille ab, und sie wird tatsächlich immer wieder mit Libidoverlust in Verbindung gebracht. In der größten Übersichtsarbeit geben aber nur 15 Prozent der Pillen-Nutzerinnen an, dass ihre Lust geringer geworden sei. Bei allen anderen ist sie gleich geblieben oder gewachsen.
Und in den Wechseljahren? Eine Hormonersatztherapie tut nichts für die Lust – allenfalls indem sie etwa durch Schwitzen zerstörte Nächte abstellt und so für mehr Wohlbefinden sorgt. Nur Testosteron schiebt die Lust wirklich an (siehe Frage 5). Viele sagen trotzdem: Ohne Östrogen macht Sex keinen Spaß mehr. Nämlich die, die mit Scheidentrockenheit zu tun haben. Laut einer Umfrage gilt das für die Hälfte der Frauen ab 50, mehr als 80 Prozent haben deshalb weniger Sex als früher. Ihnen helfen – je nachdem, wie ausgeprägt die Beschwerden sind – hormonfreie Feuchtcremes und lokal wirksame Östrogene, etwa als Zäpfchen oder Vaginalcremes. Eine Alternative kann eine vaginale Lasertherapie sein.
10. Bringen Chemikalien den Hormonhaushalt durcheinander?
Ja, auch wenn kausale Zusammenhänge beim Menschen immer schwer zu beweisen sind. Problematisch unter anderem: Phthalate, die als Weichmacher in PVC, Lebensmittelverpackungen, Kosmetik und Arzneimitteln stecken, Bisphenole, etwa aus Plastikspielzeug oder Konservenbeschichtungen, Triclosan und Parabene in Kosmetik und Zahnpflegeprodukten, polyfluorierte Alkylverbindungen aus wasserabweisenden Textilien, Pflanzen- und Flammschutzmittel. Die Folgen dieser "endokrinen Disruptoren" werden oft erst langfristig sichtbar: In einer Untersuchung kamen Töchter, deren Mütter während der Schwangerschaft große Mengen Ethylphthalate und Triclosan im Urin hatten, vier bis sechs Monate früher in die Pubertät.
Auch ein Zusammenhang der Umwelthormone mit Endometriose und Polyzystischem Ovarsyndrom PCOS wird vermutet. Außerdem werden sie damit in Verbindung gebracht, dass Männer in westlichen Ländern immer weniger Spermien produzieren, und mit der Epidemie aus Übergewicht und Diabetes ebenfalls.
Einige Stoffe sind inzwischen verboten. Jedoch nicht immer vollständig: Bisphenol A darf nicht mehr in Babyflaschen, aber immer noch in Konserven. Für andere wurden Grenzwerte eingeführt oder gesenkt, wirklich geschützt sind wir nicht. Denn die Effekte einzelner Substanzen können sich addieren. Andere sind extrem langlebig: PCB und DDT, beides seit Jahrzehnten verboten, finden sich immer noch im Urin von Kindern und Jugendlichen.
Was wir selbst tun können? Möglichst Lebensmittel unverpackt und in Bio-Qualität kaufen, wenig warmes Take-away-Essen, Fertiggerichte o. ä. nicht in der Verpackung aufwärmen, Lebensmittel nicht in Plastik aufbewahren, auf die Inhaltsstoffe von Kosmetika und bei der Inneneinrichtung auf PVC-freie Materialien achten (mehr Infos z. B. in der Broschüre "Achtung Hormongifte" vom BUND, bund.net).
11. Kann Ernährung die Hormonproduktion steuern?
Die kurze Antwort ist: nein – wenn man mal davon absieht, dass der Zyklus zusammenbricht, wenn das Körpergewicht zu sehr sinkt. Trotzdem kann man versuchen, beim Essen Hormonprobleme auszugleichen. Zum einen gibt es Phytohormone, auf denen auch das "Seed Cycling" beruht – hier isst man je nach Zyklushälfte unterschiedliche Samen und Kerne. Phytoöstrogene sind Pflanzeninhaltsstoffe, die an Östrogenrezeptoren binden können. Die Bindung ist allerdings weniger stabil, darum wirken sie viel schwächer. Phytoöstrogene gelten als Grund, warum Asiatinnen so viel weniger über Wechseljahresbeschwerden klagen, denn sie essen viel Soja, und darin stecken reichlich davon. Wie auch in Hülsenfrüchten und Leinsamen.
Zum anderen gibt es die These, dass manche Lebensmittelgruppen – von Alkohol über rotes Fleisch, Zucker, Milchprodukte, Getreide, Koffein bis Fruchtzucker – bei einigen Menschen stille Entzündungen im Körper fördern oder einfach nicht gut vertragen werden. Und dass der Verzicht darauf eine Entlastung bedeutet, die es dem Körper ermöglicht, Hormone wieder besser selbst zu produzieren. Diese Idee liegt den Detox-Kuren zugrunde, die bei Hormonproblemen angeboten werden.
12. Woran bemerkt man die Wechseljahre?
Das ist sehr unterschiedlich. Manche Frauen merken wirklich nichts, bis die Regel plötzlich wegbleibt. Dann ist aber schon sehr viel von der Hormonumstellung gelaufen, zu Veränderungen kommt es im Schnitt bereits sechs bis acht Jahre früher. Und als Erstes sinkt gar nicht der Östrogenspiegel, sondern der des Progesterons. Da es ein erstklassiges Schlaf- und Beruhigungsmittel ist (siehe Frage 7), sind Schlafstörungen und Gereiztheit typische erste Grüße von den Wechseljahren, die aber oft überhaupt nicht als solche eingeordnet werden.
Weitere frühe Zeichen sind Brustspannen und starke Blutungen. Beide haben mit wenig Gestagen und den nach wie vor unverändert hohen Östrogenspiegeln zu tun. Zu Beginn der Wechseljahre spricht man deswegen von einer Östrogendominanz. Später kommt es dann zu massiven Schwankungen der Hormonspiegel – genau das löst Hitzewallungen aus, die wohl bekanntesten Wechseljahresbeschwerden. Noch später sinken die Östrogenwerte, das spüren Frauen etwa durch trockene Haut und Schleimhäute (siehe Frage 9). Auch Gelenkbeschwerden können ein Wechseljahressymptom sein.
13. Was gibt es Neues zur Hormonersatztherapie (HRT)?
Die aktuellen Empfehlungen lauten: Hormone sind nur noch zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden gedacht, sie sollen dazu so kurz wie möglich und so niedrig dosiert wie nötig verordnet werden. Und eben nicht mehr für alle zur Prävention. Die Idee, man könnte mit ihnen Krankheiten risikofrei vermeiden, ist eindeutig Geschichte. Außerdem kommen inzwischen statt Tabletten oft Pflaster, Gels und Sprays zum Einsatz, die das Östrogen durch die Haut liefern. Auf diese Weise kann man niedriger dosieren und steigert auch nicht das Thromboserisiko.
Ein weiterer Gewinn bei der HRT sind die bioidentischen Hormone. Sie sind exakt baugleich mit den Molekülen, die von Natur aus im Körper zirkulieren. Unter den Frauen, die sich behandeln lassen, bekam 2014 jede fünfte bioidentische Hormone, nur vier Jahre später waren es 39 Prozent. Hintergrund dürfte der allgemeine "Zurück zur Natur"-Trend sein. Doch leider ist es nicht so, dass natürliche Substanzen nicht schaden können. Auch für die körpereigenen gilt, dass die Dosis das Gift macht.
Trotzdem: Wer starke Beschwerden hat, sollte keine Angst vor Hormonen haben. Es gibt wirklich nichts, das Wechseljahresbeschwerden so gut stoppt. Statt sich Sorgen über mögliche Nebenwirkungen zu machen, ist es sinnvoller zu versuchen, die grundsätzlichen Gesundheitsrisiken in den Griff zu bekommen, und das sind Übergewicht, zu wenig Sport, Zigaretten und zu viel Alkohol. Für Frauen mit Brustkrebs in der Familie, oder die selbst erkrankt waren, ist es allerdings mit einer HRT nicht ganz so einfach. Für sie ist die enge Abstimmung mit der Frauenärztin noch wichtiger.
14. Könnte man den Wechsel ewig hinausschieben?
Man schiebt ihn, wenn man Hormone nimmt, streng genommen überhaupt nicht nach hinten, man spürt nur weniger davon. Denn das Entscheidende findet trotzdem statt: Irgendwann ist die letzte Eizelle gesprungen, und wenn keine mehr da sind, gibt es keinen natürlichen Zyklus mehr, die fruchtbare Phase ist vorbei. Mit einer Hormonersatztherapie führt man lediglich die Hormone von außen zu, die vorher die Eierstöcke bzw. das zum Gelbkörper umgebaute Ei produzieren. Das Östrogen baut die Gebärmutterschleimhaut auf, egal wo es herkommt. Und wenn man es nicht durchgehend nimmt, wird die Schleimhaut in der Hormonpause abbluten, was wie eine Monatsblutung erscheint. Biologisch betrachtet kann man das sehr lange machen, nur steigen die Risiken einer Hormonbehandlung mit der Zeit (siehe Frage 13).
15. Sind wir im Alter hormonelle "Mangelwesen"?
Nein. Erstens sind die Östrogenwerte nach der Menopause gar nicht zwangsläufig so viel niedriger als in der ersten Zyklushälfte. Und zweitens muss man sie nicht grundsätzlich ausgleichen oder behandeln, anders als wenn Schilddrüsenhormone fehlen oder Insulin. Mit wenig Östrogen kann man sehr gut leben und sehr alt werden. Man kann es auch einfach umgekehrt sehen, wie die US-Brustchirurgin und Frauengesundheitsaktivistin Susan Love: das Klimakterium als das Ende eines Zuviels an Östrogen, eines übermäßig hohen Spiegels, der uns zufrieden und willig macht, unsere persönlichen Bedürfnisse jahrzehntelang zurückzustellen: schlafen, beruflich vorankommen oder einfach mal auf dem Sofa sitzen bleiben.
Die Phase des Versorgens und der Erziehung hält bei uns Menschen länger an als bei jedem anderen Säugetier. Um durchzuhalten, haben wir die hormonelle Unterstützung. Aber damit muss irgendwann Schluss sein, denn wenn Frauen bis zum letzten Atemzug menstruieren würden, hätten unsere letzten Kinder zwangsläufig schlechte Karten.
Wer spielt mit? Das Who's who der Geschlechtshormone
Östrogen Genau genommen müsste man im Plural sprechen. Es gibt nämlich mehrere Varianten des wichtigsten weiblichen Hormons, z. B. Östradiol, Östron und Östriol, die sich allerdings ziemlich ähnlich sehen. Gebildet werden sie in den Eierstöcken und in geringerer Menge in der Nebennierenrinde, während der Schwangerschaft auch in der Plazenta und nach den Wechseljahren im Fettgewebe.
Testosteron Das wichtigste männliche Hormon entsteht im weiblichen Körper in den Eierstöcken, in der Nebenniere oder durch Umwandlung von Hormonvorstufen im Fettgewebe. Neben Testosteron gibt es noch andere Androgene, zum Beispiel DHEA.
Gestagene Auch davon gibt es mehrere, mit am wichtigsten das Progesteron. Gebildet werden sie im Gelbkörper, der nach dem Eisprung aus dem im Eierstock verbliebenen Eibläschen entsteht, und während der Schwangerschaft auch in der Plazenta.