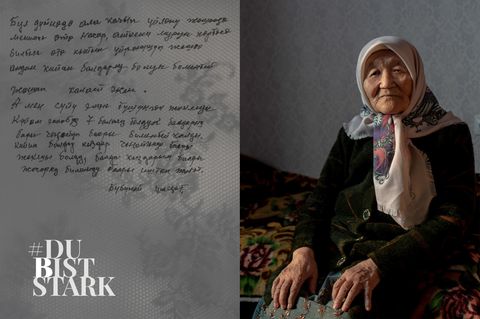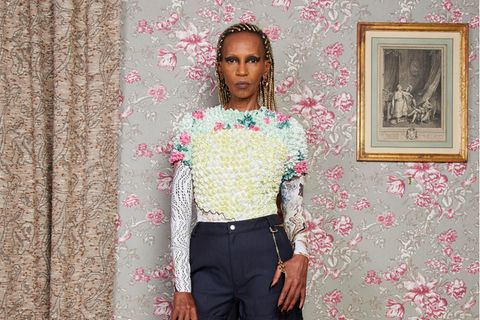Ich war mit meiner Mädelsgruppe aus, wir wollten einfach einen schönen Abend verbringen – ein, zwei Drinks und tanzen. Kaum zwei Minuten auf der Tanzfläche, da drückte sich bereits ein nassgeschwitzter Körper von hinten an mich ran, atmete mir in den Nacken und schneller, als ich überhaupt gedanklich mitkam, hatte er schon meine Taille gepackt und wiegte mich im Takt der Musik hin und her. Nach der ersten Schockstarre sah ich rot und dachte nur: "Nein! Ich will das nicht." Wie oft hatte ich mir diese Übergriffe mit 18 gefallen lassen. Ich hatte es satt. Ich entfernte mich aus der ungewollten Umarmung und forderte ihn halbwegs beherrscht, aber mit zitternder Stimme zum Gehen auf. Woraufhin ich mich mit einem pöbelnden Typen auseinandersetzen musste, der mir vorwarf, dass ich prüde sei, nicht direkt nein gesagt hätte und gleichzeitig mein "nuttiges Top" ja danach schreien würde, angefasst zu werden.
"Was hatte sie denn an?"
Diese Frage ist wohl immer noch eine der meistgestellten, wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Frauen geht – und Victim Blaming at it's best! Auch der Typ aus dem Club versuchte mir zu suggerieren, dass ich doch selbst schuld sei. Sein Fehlverhalten erwähnte er mit keinem Wort. Eine Frau mit "angemessener Kleidung" hätte den Übergriff abwenden können, ich nicht.
Nicht selten werden Betroffene von (sexualisierter) Gewalt belächelt, beschimpft oder gar selbst beschuldigt. Dieses Phänomen der Täter-Opfer-Umkehr hat es längst von der Mitte der Gesellschaft bis hinein in den Gerichtssaal geschafft hat. Durch Victim Blaming wird die Schuldfrage von den Täter:innen auf die betroffene Person verschoben, wodurch die Tat in den Hintergrund rückt. Statt Beistand und Hilfe – wie eigentlich zu erwarten – erfährt diese dann Schuldzuweisungen und muss im schlimmsten Fall ihr Trauma in ewig langen Gerichtsprozessen und Verhandlungen noch einmal durchleben.
Leider scheint Victim Blaming mittlerweile so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass es manchmal schwer ist, zu entlarven. Genau das nutzen Täter:innen aus. Wenn wir verstehen, was da passiert und wie Täter:innen manipulieren, können wir uns besser dagegen wehren. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Text zu schreiben. Victim Blaming muss endlich aufhören.
Woher kommt Victim Blaming?
Der Begriff stammt aus den USA und wurde ab den 70er Jahren verbreitet. Er beschreibt eine Strategie der Strafverteidigung bei Vergewaltigungsprozessen, die dem Vergewaltigungsopfer die Schuld an der Tat zuschreiben möchte, um den:die Angeklagte:n zu entlasten. Demnach wird Victim Blaming hauptsächlich im Kontext von sexualisierter Gewalt und Gewalt gegen Frauen oder nicht-binären Personen gebraucht. Tiefe Machtgefälle ergeben den perfekten Nährboden für Victim Blaming. Dennoch entsteht ein solches Ungleichgewicht schneller als gedacht. In unserer misogynen Gesellschaft, die von patriarchalen Strukturen geformt ist, braucht es dafür lediglich einen Mann und eine Person, die kein Mann ist.
Frauen haben bestimmte Glaubenssätze verinnerlicht: Lieber ertrage ich sie, die "versehentliche" Berührung am Po oder den Blick, der etwas zu lang auf dem Ausschnitt ruht. All das hat nichts damit zu tun, dass wir Gefallen an der Sache finden. Es ist reiner Selbstschutz, gekoppelt mit der Unsicherheit, dass uns vielleicht Schlimmeres passieren könnte, wenn wir uns deutlicher wehren würden. Victim Blaming funktioniert aus verschiedenen Gründen so gut. Einer davon beruht auf eben dieser Unsicherheit, die aus der Unterlegenheit der betroffenen Person entsteht. Wäre das nicht passiert, wenn ich mich anders verhalten hätte? Hätte ich einfach weggehen können? Oder vehementer nein sagen müssen?
Diese Fragen werden von Scham und Schuldgefühlen begleitet. Erhebt dann der:die Täter:in zusätzliche Anschuldigungen, glaubt man dem ganzen schnell selbst. Dabei geben weder ein kurzer Rock noch ein tiefer Ausschnitt jemandem das Recht, sexualisierte Gewalt auszuüben. Vorwürfe à la "Ihr Outfit hat geradezu danach geschrien" oder "Sie hat gar nicht nein gesagt" lassen immer noch Raum für Zweifel. Klar, nein heißt nein. Aber kein ja heißt eben auch nein. Selbst ein nackter Körper schreit nicht danach, angefasst zu werden. Warum dürfen insbesondere Frauenkörper nicht einfach Körper sein – ohne sexualisiert zu werden?
Warum den Betroffenen nicht geglaubt wird
Dass in Deutschland zunächst die Unschuldsvermutung gilt, ist gut. Wenn aber eine Frau, die (sexualisierte) Gewalt erfahren hat, sich traut, Anzeige zu erstatten, scheint der gesellschaftliche Reflex zu sein, ihr nicht zu glauben. Sie wird öffentlich an den Pranger gestellt, muss Beweise vorlegen und und und. Eigentlich ziemlich logisch, dass die meisten Betroffenen es sich dreimal überlegen, bevor sie Anzeige erstatten. Sie wissen, was ihnen bevorsteht: Eine Schlacht, die sie – sind wir mal ehrlich – in den meisten Fällen nur verlieren können und oft retraumatisiert verlassen.
Täter:innen im Gegenzug fahren oftmals allerhand Geschütze auf, um die Schuld von sich abzuwenden. Den Betroffenen wird unterstellt, dass sie psychisch krank seien, nicht zurechnungsfähig oder sie schlichtweg lügen, um zu Ruhm, Geld o. Ä. zu kommen. Dabei sind es laut Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe nur ungefähr drei Prozent, die sich als Falschmeldungen herausstellen. Die Dunkelziffer der Frauen, die Gewalt erfahren und diese nicht melden hingegen wird auf 85,7 Prozent geschätzt.
Der Mythos der lügenden Frau
Der Begriff Victim Blaming existiert zwar erst seit den 70er-Jahren, die Praxis, die dahintersteht hat deutlich länger Tradition. Fangen wir mal bei der Bibel an. Denn schon die begründet unter anderem den Mythos der lügenden Frau. Eva stachelte Adam an, vom Apfel der Versuchung zu kosten. Obwohl er aus freien Stücken reingebissen hat, bekam sie die Schuld an der Misere. Der arme Adam musste das Paradies verlassen, Eva wurde der Stempel "missgünstiges Weib" aufgedrückt. In vielen Geschichten sind es die Frauen, die Männer ins Verderben stürzen.
Siren, Hexen und Co. – alles hinterhältige Biester, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Männern das Leben zur Hölle zu machen. Diese Geschichten und Mythen sind natürlich längst überholt, trotzdem stellen sie die Sat der misogynen Gesellschaft dar und begründen zumindest zum Teil, warum Frauen oft nicht für voll genommen werden oder ihnen misstraut wird. Warum sollte sonst die Mehrheitsgesellschaft denken: Sicher, dass sie vergewaltigt wurde, sagt sie das nicht nur, weil sie dem Mann eins auswischen will und "fame-geil" ist?
Warum machen Frauen da mit?
Neben dem gesellschaftlichen Aspekt gibt es einen psychologischen, der Victim Blaming begünstigt. Denn häufig lässt sich beobachten, dass auch andere Frauen sich hinter die Täter:innen stellen, statt sich mit der betroffenen Person zu solidarisieren. Das lässt sich so begründen: Zum einen neigen Menschen zur "Opferbeschuldigung", wenn sie den:die Täter:in kennen und nicht wahrhaben wollen, dass diese:r zu einer Gräueltat fähig ist. Dieses Phänomen sieht man gerade bei Personen, die im Rampenlicht stehen, immer wieder. Menschen meinen, Schauspieler xy zu kennen und beurteilen zu können, ob er:sie gewalttätig ist, dabei ist das schlichtweg nicht möglich. Ein Sexualstraftäter kann sympathisch sein, dennoch bleib er ein Sexualstraftäter.
Einen weiteren Grund für "Opferbeschuldigung" stellt das eigene Sicherheitsbedürfnis dar. Menschen neigen dazu, dem:der Täter:in glauben zu wollen, weil sie sich dann sicherer fühlen. Wenn der Fehler nicht bei der betroffenen Person liegt, dann könnte ihnen ja dasselbe wie ihr passieren. Die Illusion einer sicheren Welt wird gebrochen. Indem sie jedoch glauben, dass der:die Betroffene selbst die Schuld an dem Verbrechen trägt, können sie die Illusion einer sicheren Welt aufrechterhalten.
Es muss sich etwas ändern
Der UN Women Deutschland Report zu Gewalt an Frauen für das Jahr 2022 zeigt, dass alle vier Minuten eine Frau in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt wird und alle 41 Minuten schwerer körperlicher Gewalt. Damit sich an diesen alarmierenden Zahlen etwas ändert, müssen wir als Gesellschaft aktiv daran arbeiten, gefährliche Glaubenssätze aufzubrechen. Wir müssen Betroffenen von Gewalt zuhören und glauben. Dazu gehört auch, Victim Blaming zu enttarnen und die Stirn zu bieten.
Sensibilisierung ist deshalb so wichtig, weil Victim Blaming viele Gesichter hat. Das Phänomen kommt nicht nur im Kontext von Gewalt gegen Frauen vor, sondern beschreibt auch eine Dynamik, die in "einfachen" Machtgefällen entstehen kann – wie beispielsweise im Jobkontext. Es heißt dann schnell, "Naja, Person xy hat ja mitgemacht". Dabei wird vergessen, dass in solchen Dynamiken immer eine Person Macht über eine andere hat. Es steht dann in der Verantwortung dieser Person, sich ihrer Macht bewusst zu sein und diese nicht auszunutzen. Dazu gehört auch zu wissen, dass es für die Untergebenen manchmal schwierig ist, nein zu sagen. An Machtmissbrauch können schlichtweg nur diejenigen Schuld tragen, die die Macht ausüben, nicht die, die sie erfahren.
Verwendete Quellen: unwomen.de, pinkstinks.de, frauenrechte.de, frauen-gegen-gewalt.de