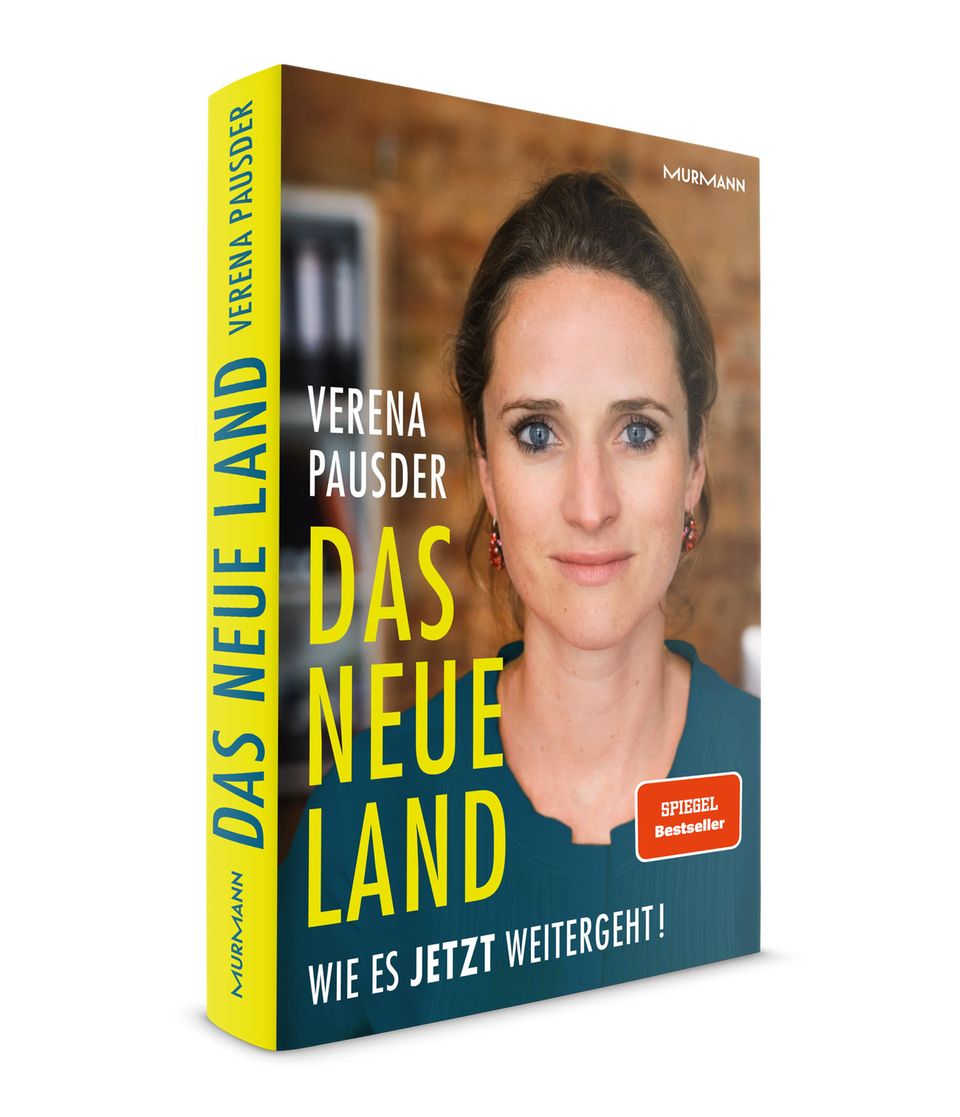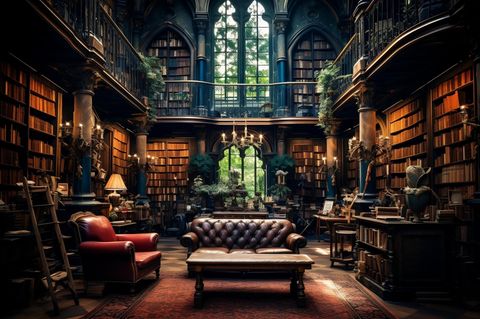BRIGITTE.de: Digitale Bildung ist eines Ihrer Herzensthemen und Sie sind eine viel gefragte Expertin auf diesem Gebiet. Was treibt Sie an, warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
Verena Pausder: Digitale Bildung ist mir wichtig, weil es in Deutschland etwas links liegen gelassen wird. Eigentlich denkt man, es müsste unser Hauptthema sein, weil es unser einziger Rohstoff ist und es werden ja auch alle immer nicht müde, das zu betonen. Und trotzdem interessiert es die Allgemeinheit immer nur so weit, wie es ihr eigenes Kind betrifft oder die Schulauswahl oder das Studium oder so. Aber es schafft es nicht, ein Thema zu werden, in das wir viel Geld, viel Brain oder viel politische Aufmerksamkeit investieren und deswegen habe ich das Gefühl, da kann man richtig was bewegen.
Die soziale Herkunft bestimmt in Deutschland mit über den Schulerfolg. Kann die Digitalisierung in der Bildung eine Chance für Schüler*innen sein, die Bildungsschere zu schließen oder zumindest zu verkleinern?
Das ist das Versprechen von Digitaler Bildung und das muss es auch sein! Es geht nicht darum, dass das, was wir bisher an den Schulen gemacht haben, jetzt digital neu zu inszenieren.
Sondern Digitale Bildung ermöglicht viel individuelleres Lernen,
sodass wir auch auf Kinder mit Lernschwächen, Sprachschwächen oder Rückständen in den einzelnen Bereichen viel individueller eingehen können, was in einer Klasse mit 30 Kindern und Lehrermangel gar nicht einfach ist. Digitale Bildung ermöglicht auch in Richtung Inklusion ganz viele Möglichkeiten, z. B. für Seh- oder Hörbehinderte Technik einzusetzen. Und es gibt tolle digitale Lösungen, mir fällt z. B. Chancenwerk e. V. ein. Die haben Cosinus erfunden, das ist ein digitales Matheprogramm für Kinder, die in Mathe zu früh abgehängt wurden und die es dann einfach nie wieder aufholen können. Digitale Bildung kann also auch außerhalb der Schule wirken, wenn kein Lehrer oder keine Eltern in der Nähe sind.
Können Eltern oder Lehrer etwas zur Digitalisierung beitragen?
Ich bringe gerne das Bild von der Zukunftsstunde in der Familie: Man setzt sich einmal die Woche mit seinen Kindern an den Tisch und bringt digitale Anwendungen, Software, Hardware etc. zusammen und dann beschäftigt man sich gemeinsam damit eine Stunde. Und nicht, dass sich in der digitalen Welt jeder in seine Ecke verkriecht. Eltern können sich mehr Mühe geben, zwischen digitalem Konsum und digitaler Kreativität zu unterscheiden. Und bei digitaler Kreativität, z. B. Erstellen eines E-Books, eines Stop-Motion-Films, eines Podcast oder ein Programmierprogramm lernen, zu sagen: Da möchte ich mit meinen Kindern mehr erleben!
Und was die Lehrkräfte angeht: So viele andere Länder arbeiten zum Beispiel mit Mentoring oder Paarlernen, man tauscht sich mehr aus. In unserem System wird man als Referendar ganz engmaschig beäugt, begutachtet und bewertet. Und danach wird man in den Schulbetrieb entlassen und es kommt nie wieder jemand vorbei, von dem man etwas lernen kann. Dabei macht es gerade beim Thema Digitale Bildung total Sinn, sich zusammen zu tun, idealerweise auch Schulübergreifend, und sich über Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen.
Die Schule von morgen gestalten
Mit einem Hackathon im Sommer 2020 wollten Sie und andere die Schule von morgen gestalten. Wie kam es dazu?
Letztes Jahr im Mai, da waren schon zwei Monate im Lockdown durch, hörte man von allen Seiten von eigentlich guten Lösungen und wie sich manche Lehrkräfte beim Thema Digitale Bildung selbst schulen. Aber es fehlte dieses eine Sprachrohr Richtung Politik! Außerdem ging es darum, die Selbstwirksamkeit der Leute möglich zu machen. Und die ganzen tollen Ideen zusammenzutragen, statt dass sie jeder im Einzelnen mit sich herumträgt. Daraus ist dann "#wirfürschule" geworden und der Bildungs-Hackathon entstanden. Dort haben wir mit über 6000 Teilnehmern an der Schule von morgen gearbeitet. Am Ende hatten wir 216 konkrete Ideen, von denen wiederum 15 als Gewinnerideen prämiert wurden und bis heute in der Umsetzung sind.
Wenn Sie sich die Schule von morgen nach allen Wünschen ausmalen könnten, wie sähe diese aus?
Die Lernräume sind viel offener und flexibler. Es gibt nicht für jede Klasse ein Klassenzimmer und das sieht überall gleich aus, sondern es gibt Lernräume, die zur Kreativität inspirieren und in denen man sich auch mehr bewegen kann. Ein anderer Punkt: Lehrkräfte, die vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter oder Lerncoach werden. Weil sie eben nicht zu 100 Prozent ihrer Zeit mit Wissensvermittlung beschäftigt sind, sondern eben auch digitale Tools und Bildung nutzen. Und viel mehr mit den Kindern ins Gespräch kommen können. Sowas alles ist sehr schwer möglich in so starren Lehrplänen und mit den klaren Kompetenzen, durch die wir so durch müssen. Was die Art des Unterrichts angeht, sollte es viel mehr projektbasierter und fächerübergreifender werden. Also zum Beispiel das Thema Ozeane im Sachkundeunterricht behandeln, dazu im Deutschunterricht einen Aufsatz oder ein Gedicht schreiben, im Kunstunterricht es digital oder analog in Szene setzen, usw. So wird es für die Kinder überhaupt greifbar, wofür sie das lernen sollen und was es mit dem echten Leben zu tun hat.
Wenn Sie eine Technologie der heutigen Zeit mit zurück in Ihre Schulzeit nehmen könnten, was wäre es?
Ich hätte gerne alle Bücher, Hausaufgaben und Arbeitsblätter in einem Tablet! Wenn ich sehe, wie sich meine Kinder da heute noch abschleppen, wie dort Zettelwirtschaft herrscht, Dinge verloren gehen oder ausgedruckt und eingescannt werden, usw. Dann denke ich einfach, das tut nicht mehr Not! Das bedeutet nicht, dass sie nichts mehr handschriftlich machen sollen! Aber diese zehn Bücher, die sie jeden Tag hin und her schleppen, auf den Verdacht hin, dass sie vielleicht zum Einsatz kommen, das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß.
Eine Krise als Chance
Sie haben selber drei Kinder. Wie ging es Ihnen und Ihrer Familie zu Beginn der Coronakrise?
Für mich persönlich war es mit den Kindern zu Hause und dem Alltag im ersten Lockdown super anstrengend. Man wusste ja auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Und die Kinder mussten sich erstmal an die Situation gewöhnen, dass ich plötzlich ihre Lehrerin war und auch, dass sie im ersten Lockdown kaum etwas von ihren Schulen gehört haben. Das fand ich wahnsinnig anstrengend und das ist wahrscheinlich repräsentativ für viele Familien.
Sie haben im ersten Lockdown die Seite homeschooling-corona.de ins Netz gestellt.
Mit der Homeschooling-Seite habe ich dieser Ohnmacht, die man damals empfunden hat, Luft gemacht bzw. sie in etwas Positives gedreht. Und ich wusste ja eigentlich selber, wie man Unterricht digital gestalten und wie ich meinen Kindern helfen kann, wenn die Lehrer*innen sich nicht so oft melden. Während ich das alles heraussuchte, habe ich gemerkt, dass das wahrscheinlich gerade super vielen helfen würde und dass es wichtig ist, das alles jetzt for free ins Netz zu stellen, damit viele davon profitieren. Da habe ich innerhalb von 4 Tagen zu Beginn des ersten Lockdowns diese Seite ins Netz gestellt und die ist hunderttausendfach aufgerufen worden. Sie hat offensichtlich einen Nerv getroffen.
Was nehmen Sie für sich aus der Coronakrise mit?
Ich werde viel mehr auf die Goldwaage legen, wo ich physisch hingehe und wo weiterhin digital. So sehr digital jetzt nervt, weil es einfach zu viel digital ist, so sehr hat es aber auch genervt für eine Veranstaltung oder ein Abendessen durch die halbe Republik zu fahren. Ich nehme auch mit, dass egal wie die Zukunft aussieht und wie digital die Welt wird,
soziale Interaktion und menschliche Nähe sind das, was das Leben ausmacht.
Diese Krise hat uns einfach gezeigt, dass selbst wenn wir in Zukunft mit Tools, Drohnen und Hyperloops usw. unser Leben bestreiten: Am Ende wollen wir uns sehen, spüren, anfassen, riechen und das ist das, was das Leben ausmacht.
Größer leite ich aus der Krise ab: Man o man Deutschland, warst du langsam in vielen Bereichen, bei denen es so wichtig gewesen wäre, dass wir schon weiter wären, wie z. B. in der digitalen Verwaltung und der digitalen Bildung. Ich hoffe, die Krise hat einen Katalysator gebracht hat, den man auch nicht mehr zurückdrehen kann.
Mehr Mutausbrüche, bitte!
Das sind Zitate aus Ihrem Buch "Das Neue Land" ...
Wir setzen die Dinge erst um, wenn Sie perfekt sind, wenn wir X Experten dazu befragt haben und wenn wir irgendwelche Gipfel veranstaltet haben, statt einfach mal pragmatisch in die Lösung und Umsetzung zu gehen und Dinge auszuprobieren. Nehmen wir mal eine Corona-App: Wäre nicht Corona gewesen, hätten wir niemals innerhalb von drei Monaten eine staatliche App entwickelt und rausgebracht, weil wir einfach so unfassbar nochmal mehr Aufwand betrieben hätten, als wir es jetzt schon gemacht haben. Und das meine ich mit Mut zur Lücke: Wir werden nicht zu jedem Zeitpunkt die Antwort auf alle Fragen und die Lösung immer perfekt haben – und trotzdem müssen wir anfangen.
Und was bedeutet Mut für Sie?
Mut bedeutet, etwas zu wagen, von dem man nicht weiß, ob es ein Erfolg wird und ob man die*der Richtige dafür ist.
Mut ist für mich einerseits nicht zu zaudern, andererseits nicht zu bereuen.
Es ist nicht nur mutig zu springen, sondern es ist dann auch mutig, wenn das Wasser kalt ist, weiterzuschwimmen. Häufig hat man Sachen, die man sich traut – aber dann hadert man damit drei Jahre, weil es nicht funktioniert hat oder bereut es, es nicht anders gemacht zu haben. Und für mich ist Mut auch: Wir probieren das jetzt, wenn es klappt, super, dann machen wir weiter. Wenn es nicht klappt, machen wir es anders. Mut ist ein Gesamt-Mind-Set.
Was war das Mutigste, das Sie je gemacht haben?
Das Mutigste, das ich je gemacht habe, war die Gründung von Fox & Sheep in 2012. Mit zwei kleinen Kindern und alleinerziehend, habe ich mein festes Gehalt aufgegeben und in einem hochkompetitiven Markt gegründet, also im Markt für Kinder-Apps weltweit. Viel Arbeit, aber wenig Garantie, dass es klappt. Im Nachhinein klingt alles immer so logisch: dann gründete sie das, dann machte sie dies und dann klappte auch das. Aber das war damals überhaupt nicht absehbar. Ich musste dafür drei Tage die Woche von Hamburg nach München pendeln, weil ich damals noch in Hamburg lebte. Ich habe kaum geschlafen, weil meine Kinder noch so klein waren und nachts schlecht schliefen und ich musste zudem immer früh aufstehen und auch nach Berlin fahren.
Scheitern ist durchaus negativ behaftet, wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, man kann seinen Weg auch ohne Scheitern gehen. Man muss nicht gescheitert sein, um erfolgreich zu sein. Mir ist wichtig, dass wenn man mal gescheitert ist und besonders, wenn man danach wieder Erfolg hat und dann sehr häufig über diesen Erfolg befragt wird, man das Scheitern nicht verheimlicht. Ich bin dafür, dass man offen darüber spricht und daraus lernt, weil am Ende die Fehler ja nur dann was Wert sind, wenn man es danach nochmal und besser macht.
Haben Sie konkrete Pläne für dieses Jahr?
Ich will den Hackathon wiederholen und ich will unsere Initiative #stayonboard über die Ziellinie bringen. Und ich überlege, ob ich nochmal gründe, weil ich denke, dass ist das, was ich im Herzen am meisten bin. Und ist das nicht auch die beste Antwort auf Zukunftsthemen, es einfach selber umzusetzen und zu gucken, wie es klappen kann? Politisch bin ich interessiert, nah dran und mache mir Gedanken gerade im digitalen Bildungsbereich und werde sehen, ob ich da einen Mehrwert sein kann. Weil ich auch nach wie vor glaube, dass es gut wäre, wenn wir mehr zwischen den Welten hin und her wechseln. Und dann muss man es natürlich auch irgendwann mal machen, statt es nur zu fordern.
"Das Neue Land" von Verena Pausder, erschienen im Murmann Verlag.
Schule neu denken, Digitalisierung vorantreiben und Gleichberechtigung fördern: Wie wollen wir in Zukunft leben und wie kommen wir dahin? Das Neue Land ist nicht nur ein Buch voller Ideen, sondern ein Appell für weniger Perfektionismus, aber für mehr Mut, mehr Ausprobieren, mehr Tun.
Hier geht es zur Porträtreihe unserer inspirierenden Frauen.