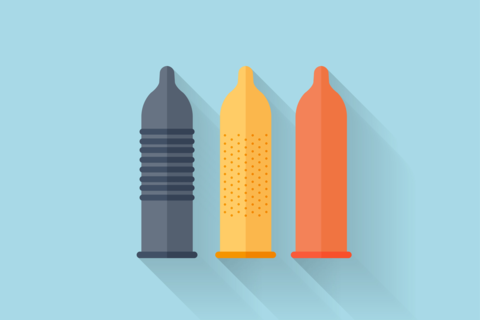image
Kommt ein Mann in ein Berliner Bordell, bucht einen Quickie, wirft sich sofort auf die ausgewählte Dame, kommt, steht auf, um sich mit der Eile eines Feuerwehrmannes anzuziehen. Einen Quickie gibt es in Berlin schon für 30 Euro. Aber so schnell muss es dann auch wieder nicht gehen, weshalb die Prostituierte ihn verwundert fragt, warum er es so eilig habe. "Meine Frau sucht gerade einen Parkplatz."
Ach so. Ja klar. Wieder was gelernt.
Die Szene findet sich im Buch "Fucking Berlin", in dem eine italienische Studentin von ihrer Zeit als Nebenjob-Prostituierte erzählt. Als heterosexuelle Durchschnittsfrau denkt man nach der Lektüre nicht nur über das Einparken und die Ahnungslosigkeit von Ehefrauen neu nach. Auch über die öffentliche Darstellung der Prostitution zum Beispiel. Seit Jahren besteht sie im Grunde aus drei Glaubenssätzen: Alle Frauen, die mit Sex Geld verdienen, sind Zwangsprostituierte, die einen werden von Männern gezwungen, die anderen von einem Kindheitstrauma. Männer gehen nicht ins Bordell, weil sie unverbindlichen Sex wollen, sondern weil sie Sex mit einer zum Objekt degradierten Frau wollen. Beides zusammengenommen macht, Dogma Nummer drei, Prostitution zum Symbol für die Unterdrückung der Frau.
Das ungefähr war mein Wissensstand, als mich vor einigen Monaten eine Bekannte auf das Internet-Tagebuch ihrer Kommilitonin aufmerksam machte, die sich ihr Leben durch Prostitution finanzierte. Sonia Rossi, so nannte sich die 25-Jährige, berichtete darin in kurzen Stücken über ihre Erlebnisse in Berliner Wohnungsbordellen. Nicht, dass darin keine fiesen Männer vorgekommen wären oder keine Frauen, die sich mit Alkohol und Kokain betäubten. Erwartbarerweise. Viel interessanter fand ich aber, dass es unter den Freiern jede Menge netter Männer gab sowie attraktive Männer, einsame Männer, zärtliche Männer und eine ganze Armee heulender Männer. Ein Bordellbesuch erfüllt für liebeskranke Männer offenbar dieselbe Funktion wie für Frauen ein Wellness-Wochenende. Überraschend fand ich auch die Haltung der Autorin, die darauf beharrte, weder von einem Mann noch durch ein Kindheitstrauma zu dem Job gezwungen zu sein. Ihr Weg ins Milieu sei eher ein Prozess der Desensibilisierung gewesen: von der Webcam-Stripperin über erotische Massage bis zum Vollprogramm.
"Du meinst, im Prinzip könnte das jeder Frau passieren?", wollte ich wissen. "Na ja, wenn die Armut groß genug ist, sinken alle möglichen Schwellen." - "Aber doch nicht die", beharrte ich. "Dann hast du es noch nie erlebt, wie es ist, nur noch zehn Euro zu besitzen", sagte sie. Immerhin gab sie zu, dass viele Neueinsteigerinnen sofort wieder aufhören, egal, wie desolat ihre finanzielle Situation sei: "Entweder du gehst in der ersten Woche, oder du überwindest den Ekel vor Schwänzen."
Sonia war selbstbewusst genug, um in Prenzlauer-Berg-Cafés zwischen Müttern und Babys laut über diese Dinge zu sprechen. Außerdem war sie eloquent und lustig. Ich sagte ihr, dass ich das für ein tolles Thema für ein Buch hielte, und sie gestand mir, dass sie bereits mehrere Kapitel in ihrem Computer hätte. Als ich wenige Monate später das Manuskript in den Händen hatte, stolperte ich von einer Überraschung in die nächste: Es spielte dort, wo gute Geschichten spielen, in dem unübersichtlichen Gelände jenseits der Dogmen. Denn es handelte nicht von Monstern und Opfern, sondern von Männern und Frauen.
image
Da gibt es Wolfgang, den netten Rentner aus Marzahn, dessen einziges Vergnügen noch darin besteht, ab und zu bei Jazz und Rotwein an einem Callgirl zu fummeln. Dabei schwelgt er in alten Geschichten aus dem Ostberliner Theatermilieu. Als er schließlich mit einem Herzinfarkt auf der Intensivstation liegt, wacht an seinem Bett eine Volleyballmannschaft besorgter Callgirls (er überlebt). Natürlich gibt es unter den Kunden viele Brutalos und Idioten. Aber es gibt eben auch jenen spindeldürren Bauarbeiter, der erst eine Freundin hatte und sich begierig von Sonia in die Grundkenntnisse des guten Sex einweisen lässt und sich dabei in sie verliebt. Ein New Yorker Galerist wird einen Sommer lang ihr Stammgast, und am Ende wissen beide nicht so recht, ob der andere davon ausgeht, dass ihre Geschäftsbeziehung jetzt beendet sei. Am letzten Abend gibt er ihr verlegen seine E-Mail-Adresse: Wer hat noch mal behauptet, dass Männer für Sex bezahlen, damit sie dabei nichts fühlen und nicht geben müssten?
Die Wohnungspuffs, in denen Sonia arbeitet, werden zum größten Teil von Frauen geführt. Zuhälter gibt es wohl, sagt sie, auf dem Straßenstrich in Schöneberg zum Beispiel, auf dem ausländische Frauen arbeiten, die von einer Stadt in die nächste gekarrt werden, viele drogensüchtig, manche minderjährig. Aber mit dieser Szene hatte sie nie etwas zu tun. Die meisten ihrer Kolleginnen sind alleinerziehende Mütter, manche füttern außerdem einen arbeitslosen Tunichtgut mit durch. Man kann in Berliner Puffs nicht reich werden, aber man kann dort zu krippenkompatiblen Zeiten mehr Geld verdienen als bei Schlecker. Es ist eine Entscheidung zwischen zwei Übeln, aber sie wird von Sonia nicht als Zwang geschildert, sondern als Zwangslage. Selbst einige Prostituierte aus Osteuropa, die unter falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt wurden, gestehen in Gesprächen unter Kolleginnen, dass sie bereits zu Hause geahnt hätten, dass sie in Berlin nicht als Bedienung arbeiten würden. Nur eine Frau, die Sonia in den fünf Jahren kennen lernte, war tatsächlich das, was man sich unter einer Zwangsprostituierten vorstellt. Drei Jahre lang wurde Vera von einer russischen Bande festgehalten, die ihren Pass einkassiert hatte. Aber mit Menschenhändlern wird in dem Buch so kurzer Prozess gemacht wie mit Klischees. "Igor kam bei einer Bandenschießerei ums Leben, und seitdem genoss Vera ihre neue Freiheit. Sie wohnte jetzt mit einem Araber zusammen, der ein Solarium hatte, und schickte ihr Geld fleißig nach Estland, wo ihre Eltern und ihre vierjährige Tochter immer noch lebten."
Und Sonia Rossi selbst, die Studentin? "Ich habe es gehasst, ständig pleite zu sein", sagte sie, als wir uns kennen lernten. "Ich musste als Kind nie auf etwas verzichten, und als es meinen Eltern später finanziell schlechter ging, war ich nicht daran gewöhnt zu sparen." Ich glaubte ihr natürlich nicht. Ich dachte, dass ich irgendwann verstehen würde, welche Verletzung dazu geführt haben könnte, dass sie sich diesem Job aussetzte.
Aber die, die ich kennen lernte, war eine 25-Jährige, deren Abenteuerlust offenbar größer war als alles andere. Mit Geld konnte sie tatsächlich überhaupt nicht umgehen, und mit ihrem Männergeschmack stand es auch nicht zum Besten - von ihrem Verdienst fütterte sie ihren stark kiffenden Freund durch. Außerdem war sie ehrgeizig und wollte beim Studium keine Zeit verlieren. Sie schien es einfach weniger schlimm zu finden, sich zu prostituieren, als auf Essengehen, Taxifahren oder ihren Freund zu verzichten. Vermutlich spielt es auch eine Rolle, dass sie aus der Tatsache, dass ein Mann - irgendein Mann - sie erregend findet, eine Bestätigung zu ziehen scheint: Sie sagt, ihr Sexleben sei auch früher schon ausschweifend gewesen. Vermutlich ist diese Form von Sex-Narzissmus eine Voraussetzung, um überhaupt auf die Idee zu kommen, in das Gewerbe einzusteigen. Das mag von wenig Selbstwertgefühl zeugen, aber es ist nicht dasselbe, wie als Kind sexuell missbraucht worden zu sein.
Manchmal liest sich Sonias Buch, als sei es ihr auch darum gegangen, möglichst viele Geschichten zu sammeln, von denen sie eines Tages erzählen würde. Als Kind in Italien träumte sie davon, Schriftstellerin zu werden, als Teenager gewann sie einen Literaturwettbewerb.
In Frankreich ist vor einem Jahr ein Buch erschienen, in dem eine Studentin ihre Erfahrungen in Bordellen beschreibt, in England gab es "Belle de Jour", die Memoiren eines Londoner Luxus-Callgirls, ähnliche Bücher kamen in Schweden und Brasilien heraus. In diesen Texten wird Prostitution als Weiterentwicklung des "Sex and the City"-Lifestyles geschildert, nur dass es für anonymen Sex nun praktischerweise auch noch Geld gibt.
So klingt "Fucking Berlin" überhaupt nicht. Es besteht keine Gefahr, dass jemand Prostitution danach für einen Traumjob hält. Aber es ist auch kein Buch über Scheißtypen und arme Frauen, sondern über Menschen, die auf eine unterschiedliche Weise bedürftig sind. Manchmal flackert so etwas wie Sympathie und Solidarität zwischen ihnen auf, an einem Ort, der dafür ungeeignet erscheint.