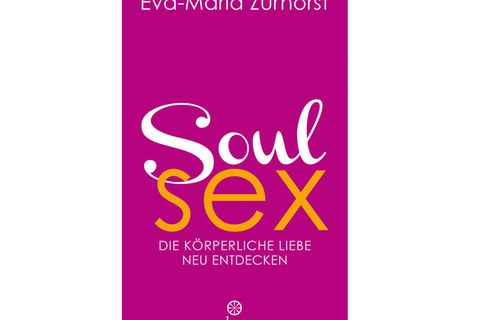Im Fall von Taiye Selasi hat Gott die mit Schönheit, Glamour, Klugheit und literarischem Talent gefüllte Gießkanne ziemlich lange über eine einzige Person gehalten. Und das gönnen wir ihr, denn die Frau, die als Tochter einer nigerianisch-schottischen Kinderärztin und eines ghanaischen Chirurgen in London geboren wurde und in Massachusetts aufwuchs, hat mit ihrem Erstling "Diese Dinge geschehen nicht einfach so" (mehr dazu in der aktuellen BRIGITTE Woman) eines der schönsten Bücher des Jahres geschrieben. Einen biografisch gefärbten Roman, der eine Reise ist in das Herz einer afrikanischen Einwandererfamilie in den USA - gehobene Mittelschicht, Yale- und Oxford-Absolventen wie Taiye Selasi, Ärzte, Juristen, Künstler. Sechs Menschen, die sich verletzen und verlieren und denen erst Jahre später die Versöhnung auf afrikanischem Boden gelingt. Der Roman sprengt mit Wucht das Klischee des armen Afrikaners ohne Bildung und Ehrgeiz.
Zur Ikone einer ganzen Generation junger Menschen mit akademischem Abschluss und afrikanischen Wurzeln wurde Taiye, die heute in New York und Rom lebt, bereits 2005 durch einen Essay im alternativpolitischen "LIP Magazine", der sich später rasend schnell im Internet verbreitete. Als Studentin beschrieb sie dort ihr Dasein zwischen Kontinenten und Kulturen und erfand dafür den mittlerweile weltweit benutzten Begriff "Afropolitan": "Diese neueste Generation afrikanischer Auswanderer erkennt man an der Kombination von Londoner Mode, New Yorker Jargon, afrikanischen Wertvorstellungen und akademischen Erfolgen. Sind wir nicht die coolste Generation der Welt?"
Seitdem wird sie sogar von berühmten Schriftstellern wie Salman Rushdie und Toni Morrison verehrt. Selasi findet das normal, genau wie die Tatsache, dass die Muse sie nicht erst nach langem Grübeln, sondern spontan unter einer Dusche geküsst hat und ihr Buch schon vor Erscheinen in 15 Länder verkauft wurde. Ihre Mutter hatte ihr schon früh gepredigt, dass Ehrgeiz ein Muss ist. Seitdem sucht Taiye Selasi sich ihre Vorbilder ganz weit oben. "Ich bin nicht so schöpferisch wie Gott. Aber ich gebe mein Bestes."
Lesungen: Taiye Selasi auf Tour in Deutschland und in der Schweiz
- 13.04.2013, Berlin, KulturBrauerei
- 14.04.2013, Heidelberg, Deutsch-Amerikanisches-Institut
- 16.04.2013, Zürich, Kaufleuten
- 17.04.2013, Freiburg, Peterhofkeller der Universität Freiburg
- 18.04.2013, Frankfurt, Literaturhaus Frankfurt
- 19.04.2013, Lüneburg, Roy Robson Konzepthaus
- 20.04.2013, Hamburg, Tierpark Hagenbeck
- 25.04.2013, Stuttgart, Theaterhaus
Leseprobe aus "Diese Dinge geschehen nicht einfach so" von Taiye Selasi
image
Eins Kweku stirbt barfuß, an einem Sonntag vor Sonnenaufgang, seine Hausschuhe kauern an der Tür zum Schlafzimmer, wie Hunde. Jetzt steht er auf der Schwelle zwischen Glasveranda und Garten und überlegt, ob er zurück soll, um die Pantoffeln zu holen. Er holt sie nicht. Seine zweite Frau, Ama, schläft dort im Schlafzimmer, die Lippen leicht geöffnet, mit gerunzelter Stirn, ihre heißen Wangen auf der Suche nach einer kühlen Stelle auf dem Kopfkissen, Kweku will sie nicht wecken. Er hätte es auch gar nicht geschafft, selbst wenn er’s versucht hätte. Sie schläft wie eine Cocoyam. Ein Ding ohne Sinnesorgane. Sie schläft wie seine Mutter, abgeschnitten von der Welt. Das Haus könnte von Nigerianern in Flipflops leergeräumt werden - sie könnten in verrosteten russischen Armeepanzern direkt bis vor die Tür rollen, ohne Rücksicht auf Verluste, so wie sie das jetzt auf Victoria Island in Lagos machen (jedenfalls hört er das von seinen Freunden, Rohöl-Könige und Cowboys, die nach Greater Lagos vertrieben wurden, diese seltsame Sorte Afrikaner: furchtlos und reich). Ama würde sanft und selig weiter schnarchen, die musikalische Untermalung eines Traums vom Tanz der Zuckerfee und von Tschaikowski.
Sie schläft wie ein Kind. Er denkt den Gedanken trotzdem, nimmt ihn mit vom Schlafzimmer zur Glasveranda; ein demonstrativer Akt der Vorsicht. Eine Show für ihn selbst. Das macht er schon lange, eigentlich seit er von seinem Dorf weg ist, kleine Freilichtspiele für ein Ein-Mann-Publikum. Oder für zwei Personen. Für ihn und seinen Kameramann, den stummen-unsichtbaren Kameramann, der damals, vor vielen Jahrzehnten, gemeinsam mit ihm abgehauen ist, heimlich, in der Dunkelheit, noch vor Anbruch der Dämmerung, der Ozean ganz in der Nähe. Dieser Kameramann, der ihm seither immer und überallhin folgt. Und schweigend sein Leben filmt. Oder: Das Leben des Mannes, der er sein möchte und der er nicht mehr werden wird. Diese Szene nun, eine Schlafzimmerszene: der einfühlsame Ehemann. Der keinen Mucks von sich gibt, als er aus dem Bett schlüpft, der geräuschlos die Decke zur Seite schlägt, einen Fuß nach dem anderen auf den Fußboden setzt und sich die größte Mühe gibt, seine nicht-weckbare Ehefrau ja nicht zu wecken. Ja nicht zu schnell aufstehen, weil sich sonst die Matratze bewegt. Ganz leise durchs Zimmer schleichen, lautlos die Tür schließen. Dann genauso lautlos den Flur entlang, durch die Tür zum Innenhof, wo sie ihn garantiert nicht mehr hören kann. Trotzdem immer noch auf Zehenspitzen. Den kurzen, geheizten Verbindungsgang vom Schlaftrakt zum Wohntrakt, wo er einen Moment stehen bleibt, um sein Haus zu bewundern.
Es ist eine geniale Komposition, diese einstöckige Anlage, nicht besonders originell, sondern funktional und vor allem elegant durchgeplant. Ein schlichter Hof in der Mitte, mit einer Tür auf jeder Seite, zum Wohntrakt, zum Esstrakt, zum großen Schlafzimmer, zu den Gästezimmern. Er hat den Entwurf in einer Krankenhauscafeteria auf eine Serviette gekritzelt, im dritten Jahr seiner Facharztausbildung, mit einunddreißig. Mit achtundvierzig kaufte er das Grundstück von einem Patienten aus Neapel, einem reichen Immobilienmakler mit Verbindungen zur Mafia und mit Diabetes Typ II, der nach Accra gezogen war, weil die Stadt ihn an Neapel in den fünfziger Jahren erinnert, wie er behauptet (der Reichtum so nah beim Elend, die frische Seeluftv so nah beim Abwasser, am Strand stinkreiche Leute neben stinkarmen.) Mit neunundvierzig fand er einen Zimmermann, der bereit war, den Auftrag anzunehmen – der einzige Ghanaer, der sich nicht weigerte, ein Haus mit einem Loch in der Mitte zu bauen. Dieser Zimmermann war siebzig, mit grünem Star und Sixpack. Er arbeitete einwandfrei und immer allein, und nach zwei Jahren war er fertig. Mit einundfünfzig brachte Kweku seine Sachen her, fand es aber zu ruhig. Mit dreiundfünfzig heiratete er zum zweiten Mal. Elegant geplant. Nun bleibt er an einer Seite des Quadrats stehen, zwischen den Türen. Hier ist die Struktur deutlich zu erkennen, er kann den Entwurf sehen, und er betrachtet ihn, so wie der Maler ein Gemälde betrachtet oder die Mutter das Neugeborene. Voller Verwirrung und Ehrfurcht, dass dieses Ding, das irgendwo im Kopf oder im Körper konzipiert wurde, es nach draußen in die Welt geschafft hat, und jetzt ein Eigenleben hat. Etwas perplex. Wie ist es hierhergekommen, von in ihm zu vor ihm? (Klar, er weiß, durch die richtige Verwendung des entsprechenden Werkzeugs; das gilt für den Maler, die Mutter, den Amateur-Architekten – aber trotzdem ist es ein Wunder, wenn man es so vor sichv sieht.) Sein Haus. Sein schönes, funktionales, elegantes Haus, das ihm als Ganzes erschienen ist, als Gesamtkonzept, in einem einzigen Augenblick, wie eine befruchtete Eizelle, die unerklärlich aus der Dunkelheit herausgeschleudert wird und einen vollständigen genetischen Code enthält. Ein logisches System. Die vier Quadranten: eine Verbeugung vor der Symmetrie, vor seiner Ausbildung, vor Millimeterpapier, vor dem Kompass, ewige Reise, ewige Rückkehr und so weiter, ein grauer Innenhof, nicht grün, glänzender Stein, Schieferplatten, Beton, sozusagen eine Widerlegung der Tropen, der Heimat. Das heißt, die Heimat neu gedacht, alle Linien klar und gerade, nichts üppig, weich oder grün. In einem einzigen Augenblick. Alles da. Hier und jetzt. Jahrzehnte später in einer Straße in Old Adabraka, einer verfallenden Vorstadt aus Kolonialvillen, weißer Stuck, streunende Hunde. Das Haus ist das Schönste, was er je geschaffen hat – außer Taiwo, denkt er plötzlich. Der Gedanke ein Schock. Woraufhin Taiwo selbst vor ihm erscheint – die Wimpern ein schwarzes Dickicht, die Wangenknochen gemeißelter Fels und Edelsteine als Augen, ihre rosaroten Lippen, die gleiche Farbe wie das Innere eines Muschelhorns, unmöglich schön, ein unmögliches Mädchen – und seine "Einfühlsamer Ehemann"-Szene stört. Dann löst sie sich in Rauch auf. Das Haus ist das Schönste, was er je allein geschaffen hat, korrigiert er sich. Dann geht er den Verbindungsgang zum Wohntrakt weiter, durch die Tür ins Wohnzimmer, durch das Esszimmer, zur Glasveranda und zur Schwelle. Wo er stehen bleibt.
Zwei Später am Morgen, als es angefangen hat zu schneien und der Mann aufgehört hat zu sterben und ein Hund den Tod gerochen hat, wird Olu ohne große Eile das Krankenhaus verlassen, sein Blackberry ausschalten, den Kaffee abstellen und zu weinen anfangen. Er wird keine Ahnung haben, wie der Tag in Ghana angefangen hat, er wird Meilen und Ozeane und Zeitzonen weit entfernt sein (und noch andere Arten von Entfernungen, die schwerer zu überwinden sind, wie gebrochene Herzen und Wut und versteinerter Schmerz und all die Fragen, die zu lange ungefragt oder unbeantwortet blieben, und Generationen von Vater- Sohn-Schweigen und Scham), während er Sojamilch in den Kaffee rührt, in einer Krankenhauscafeteria, mit verschwommenem Blick, unausgeschlafen, hier und nicht da. Aber er wird es sich vorstellen – sein Vater, dort, tot in einem Garten, ein Mann, gesund, siebenundfünfzig, in bemerkenswert guter Verfassung, kleiner-runder Bizeps unter der Haut seiner Oberarme, kleiner runder Bauch unter seinem Unterhemd, einem Fruit of the Loom-Feinripp-Unterhemd, sehr weiß auf dunkelbraun, dazu diese lächerlichen MC Hammer-Hosen, die er, Olu, hasst und die Kweku liebt – und obwohl er es versucht (er ist Arzt, er weiß Bescheid, er kann es nicht ausstehen, wenn seine Patienten ihn fragen "Was ist, wenn Sie sich irren?"), wird er den Gedanken nicht los. Dass die Ärzte sich irren. Dass solche Dinge nicht "manchmal passieren". Dass dort etwas passiert ist. Kein Arzt mit seiner Erfahrung und erst recht kein so außergewöhnlich guter Arzt – und man kann sagen, was man will, aber der Mann war erstklassig in seinem Beruf, selbst seine Widersacher geben das zu, ein "Künstler am Skalpell", ein Chirurg, der seinesgleichen sucht, ein ghanaischer Carson und so weiter – kein Arzt dieses Kalibers hätte sämtliche Anzeichen eines sich so langsam aufbauenden Herzinfarkts übersehen können. Typische Koronarthrombose. Null Problem. Schnell handeln. Und er hätte genug Zeit gehabt, eine halbe Stunde, und das scheint eher untertrieben, nach allem, was Mom erzählt, dreißig Minuten, um zu handeln, um zur "Ausbildung zurückzukehren", wie Dr. Soto sagen würde, Olus Lieblings-Oberarzt, sein Xicano- Hausheiliger. Symptome durchgehen, Diagnose erstellen, aufstehen, ins Haus gehen, die Frau aufwecken, und falls die Frau nicht Auto fahren kann – wovon auszugehen ist, sie kann nicht lesen – selbst ans Steuer setzen und sich in Sicherheit bringen. Und Pantoffeln anziehen, Herrgott nochmal. Aber er tat nichts dergleichen. Ging nichts durch, erstellte nichts. Durchquerte nur eine Glasveranda, fiel ins Gras. Ohne ersichtlichen Grund – oder aus undurchschaubaren Gründen, die Olu nicht ahnen kann und die er, zur Unwissenheit verdammt, nicht verzeihen kann – blieb sein Vater liegen, Kweku Sai, die Große Hoffnung der Ga, der verlorene Sohn, das verlorene Wunderkind, lag einfach da in seinen Schlafsachen und tat gar nichts, bis die erbarmungslose Sonne aufging, weniger ein Aufgang als ein Aufstand, Tod dem fahlen Grau durch das goldene Schwert, während drinnen die Ehefrau die Augen aufschlug und die Pantoffeln in der Tür stehen sah. Und weil sie das seltsam fand, ging sie ihn suchen und fand ihn. Tot. Ein außergewöhnlicher Chirurg. Und ein gewöhnlicher Herzinfarkt.
Durchschnittlich hat man vierzig Minuten zwischen Beginn der Attacke und Tod. Also selbst wenn es stimmt, dass solche Dinge "manchmal" passieren, das heißt, wenn es stimmt, dass gesunde Herzen sich "manchmal" verkrampfen, einfach so, aus heiterem Himmel, wie ein Wadenkrampf, besteht immer noch die Frage der Zeit. Die ganzen Minuten dazwischen. Zwischen dem ersten Stich und dem letzten Atemzug. Speziell diese Momente faszinieren Olu, er ist besessen von ihnen, schon sein ganzes Leben, in der Jugend als Sportler, dann später als Arzt. Die Momente, die das Ergebnis bestimmen. Die stillen Momente. Dieses zerrissene Schweigen zwischen Auslöser und Handlung, wenn sich das Denken nur auf das konzentriert, was der Augenblick fordert, und die ganze Welt sich verlangsamt, als wollte sie sehen, was passiert. Wenn der eine handelt und der andere nicht. Die Momente, nach denen es zu spät ist. Nicht das Ende selbst – diese wenigen, verzweifelten und schrillen Sekunden, die dem endgültigen Signalton vorausgehen oder dem langgezogenen Piepsen der Nulllinie –, sondern die Stille davor, die Unterbrechung des Geschehens, die Pause. Diese Pause gibt es immer, das weiß Olu, ausnahmslos. Die Sekunden, gleich nachdem die Pistole losgegangen ist und der Läufer unten bleibt oder zu früh hochkommt. Oder nachdem das Schussopfer spürt, wie die Kugel seine Haut zerreißt, und mit der Hand nach der Wunde tastet oder nicht. Die Welt steht still. Ob der Läufer gewinnt und ob der Patient durchkommt, hat letzten Endes weniger damit zu tun, wie er die Linie überquert, als vielmehr damit, was er in den Augenblicken kurz davor getan hat. Kweku hat nichts getan, und Olu weiß nicht, warum. Wie konnte sein Vater nicht merken, was los war? Und wenn er es merkte, wie konnte er dann dort liegenbleiben, um zu sterben? Nein. Irgendetwas musste passiert sein, was ihm die Orientierung nahm, ein überwältigendes Gefühl, eine geistige Verwirrung. Olu weiß nicht, was es war. Er weiß nur so viel: ein aktiver Mann, unter sechzig, keine Krankheiten bekannt, aufgewachsen mit Frischwasserfisch, läuft jeden Tag fünf Meilen, vögelt eine attraktive Dorfidiotin – man kann sagen, was man will, aber diese neue Ehefrau ist keine Krankenschwester. Es ist sinnlos, Vorwürfe zu erheben, aber es hätte vielleicht Hoffnung gegeben, die richtige Herzdruckmassage/wenn sie aufgewacht wäre – aber so ein Mann stirbt nicht in einem Garten an einem Herzstillstand. Etwas muss ihn zum Stillstand gebracht haben.