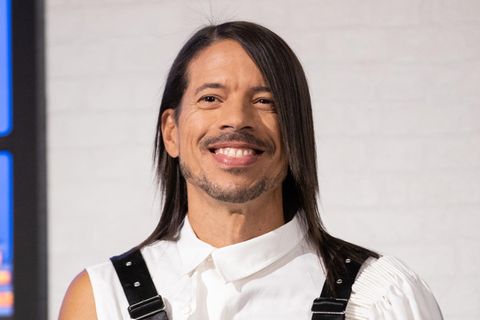Als ich vor etwa einem Jahr unbedarft die erste Folge der Netflix-Serie "Heartstopper" sah, konnte ich nicht ahnen, dass mich – und viele andere queere Menschen auf der Welt – eine emotionale Achterbahnfahrt erwarten würde. Das Ende dieser wundervollen, mitreißenden, charmanten Serie hinterließ mich mit einem unerwartet tiefen Gefühl der Trauer: Ich durfte Jugendlichen dabei zusehen, wie sie ihre erste queere Liebe erlebten – und musste der Tatsache ins Auge blicken, dass diese Jugend für mich nie Realität sein würde.
Meine bestand aus der vermeintlich unumstößlichen und von vielen Mitmenschen regelmäßig bestärkten Tatsache, dass Queerness etwas Falsches sei. Wer queer (in meinem Fall schwul) ist, der wird zum Ziel von Gespött, vulgären Beleidigungen, tätlichen Angriffen. Und hat es nicht anders verdient. Das ist die Jugend, wie ich sie erlebt habe, wie viele Menschen sie erlebt haben und heute noch erleben. Für mich – und für manch andere womöglich auch – geht es im Pride Month nicht vornehmlich darum, laut, präsent und bunt zu sein. Sondern den anerzogenen Selbsthass zu überwinden, jeden Tag ein bisschen mehr.
Jeden Tag werden vier queere Personen Opfer von Gewalt
Eine fiktive Serie wie "Heartstopper" weckte ambivalente Emotionen in mir. Wie bereits erwähnt, gab es da die eine Seite: die melancholische, die darum trauerte, was sie so nie erleben würde – die erste große Jugendliebe. An so etwas habe ich nicht einmal gewagt zu denken, damals. Doch auch eine andere Seite traute sich in jener Zeit aus mir hervor: die hoffnungsvolle, die Seite in mir, die sich für andere Menschen wünscht, dass sie nicht diese quälenden Zweifel durchleben müssten, die Schikanen und dieses erdrückende Gefühl der Einsamkeit und des Verlorenseins.
Doch die Realität ließ bisher noch jede naive Hoffnung zerplatzen: Statistisch gesehen werden in Deutschland jeden Tag vier queere Personen Opfer einer Gewalttat, was aus Zahlen des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes hervorgeht. Das bedeutet in Ziffern 1.005 Hassdelikte in 2022, ein Jahr davor waren es 870, das entspricht einer Steigung von 16 Prozent. "Diese Zahlen können nur die Spitze des Eisbergs sein", sagt die Queerpolitikerin Ulle Schauws (Grüne) im Gespräch mit "queer.de" und meint damit die Dunkelziffer der Hasskriminalität gegen queere Menschen, schließlich wird nicht jedes Delikt zur Anzeige gebracht. Beleidigungen, Ausgrenzung, Bedrohungen – wie viele davon landen vor dem Gericht? Ihren Platz finden sie dagegen sehr sicher im Kopf eines Menschen, der diesen Dingen täglich ausgeliefert ist.
Wir müssen nicht nach Florida schauen, wo aktuell unter anderem eine regelrechte Hetzkampagne gegen Queerness geführt wird. Auch hier in Deutschland, wo nicht wenige Menschen müde werden, "ständig" von queeren Themen lesen und hören zu müssen, ist die Lage alles andere als gut – auch wenn queeren Menschen das ja sehr gerne so verkauft wird. Laut der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Luise Amtsberg, droht queeren Menschen in mehr als 60 Staaten auf der Welt strafrechtliche Verfolgung, in sieben gar die Todesstrafe. Und in Deutschland sei die Lage mit Blick auf die Straftaten gegen queere Menschen auch sechs Jahre nach Einführung der Ehe für alle "noch längst nicht gut", so Amtsberg.
Worum es manchen beim Pride Month auch geht
Was passiert im Kopf eines Menschen, der regelmäßig Diskriminierung erfährt? Dem immer und immer wieder gesagt wird: "Du bist falsch. Du bist ekelhaft. Ich hoffe, du stirbst." Kürzlich stellten zwei Wissenschaftlerinnen in einer Meta-Analyse fest, welch immensen Schaden Mobbing im Gehirn von jungen Menschen anrichten kann. Das neurologische Zusammenspiel zwischen den Hirnregionen würde "zur Empfindlichkeit gegenüber Gesichtsausdrücken, schlechten kognitiven Schlussfolgerungen und Stress" beitragen, welche die Verhaltenssteuerung und Emotionsregulation negativ beeinflussen würden.
Was bedeutet das? Letztlich, dass ein Kind die Gesichtsausdrücke seiner Mitmenschen und ihr Verhalten auf die schlimmstmögliche Weise interpretiert, dauernd auf der Hut ist und mit der Angst leben muss, jeden Moment verbal oder körperlich angegriffen zu werden. So wie mein Ehemensch und ich, wenn wir zusammen in der Bahn sitzen, uns berühren, zusammen lachen, uns umarmen. Wir beide spüren die Blicke auf uns, die Verurteilung. Die Angst, die regelmäßig in mir aufsteigt, wenn sich uns eine männlich gelesene Person nähert, die Gedanken an all die Menschen, die bereits ermordet wurden, weil sie queer sind – das wünsche ich niemandem.
Der Hass, die Anfeindungen, das Unverständnis, die schiefen Blicke: Queere Menschen erfahren jeden Tag auf der ganzen Welt Diskriminierung. Ob sie als männlich gelesene Personen ein Kleid tragen und angefasst werden, ob man sie beschimpft, weil sie mit einer augenscheinlich gleichgeschlechtlichen Person Händchen halten, ob man sie ins Koma prügelt, weil sie es wagen, für ihre Grundrechte einzustehen und den Mund aufzumachen. "Wir alle wachsen mit Homo- und Transfeindlichkeit auf, und queere Kinder haben keine magischen Ohrstöpsel", schreibt Autor Matthew Todd für "The Guardian".
All das macht etwas mit Menschen, auch wenn wir das alle nicht wollen – ich für meinen Teil möchte jenen Peiniger:innen der queeren Menschen nicht die Genugtuung geben, dass das, was sie sagen und tun, verletzt. Ich möchte darüberstehen. Ich möchte meinen Wert kennen, stolz sein, auf die Person, die ich wurde – nicht durch mein Umfeld, sondern trotz meines Umfelds während des Großteils meiner gesamten Kindheit und frühen Jugend. Manche queeren Personen erzählen, dass sie besonders witzig oder besonders freundlich im Umgang mit Menschen sind, um bloß nicht als Gefahr, bloß nicht als Zielscheibe betrachtet zu werden. Andere sind wütend und laut. Und wieder andere tauchen sich in Glitzer, gehen auf die Straße und machen die graue Welt um sich herum bunter.
Wir alle haben unsere Umgangsstrategien und glücklicherweise haben nicht alle von uns einen tief verwurzelten Selbsthass. Doch wir alle sind in einer heteronormativen Welt aufgewachsen, die uns lange Zeit und auch heute noch vor allem eine Sache sagt: So wie ihr seid, seid ihr nicht richtig. Das wird eine heterosexuelle cis Person zum Glück – und leider – wohl nie nachempfinden können.
Deswegen zuletzt eine Bitte an jene Mehrheitsgesellschaft: Wenn ihr das nächste Mal das Gefühl habt, all diese queeren Menschen seien "zu viel", "zu laut", "zu präsent", dann bedenkt bitte, dass viele dieser Menschen lange Zeit ihres Lebens unterdrückt, beleidigt und verletzt wurden und manche bis heute noch werden. Bedenkt, dass sie "viel" und "laut" und "präsent" sind, weil nicht wenige Menschen auf der Welt sie am liebsten nichtexistent wüssten und alles in ihrer Macht Stehende tun, das zu erreichen.
Bedenkt, dass einige von ihnen den Selbsthass verlernen möchten, den sie ihr ganzes Leben lang von ihrem Umfeld anerzogen bekommen haben.
Verwendete Quellen: queer.de, zdf.de, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, theguardian.com, vox.com