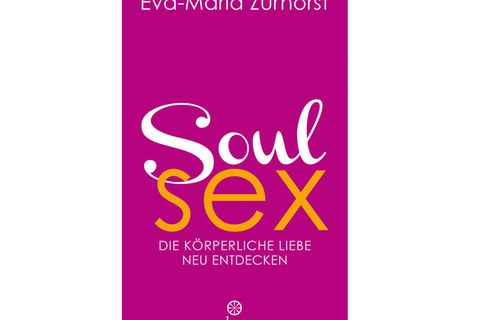Die Autorin
image
Lilly Lindner ist 26 Jahre alt, eine zarte Frau mit schönen dunklen Augen. Sie mag Worte und arbeitet gerne mit Kindern. Nichts deutet auf den ersten Blick darauf hin, dass im Innern dieses Mädchens seit 20 Jahren die Hölle tobt. Eine Hölle, die sie nun in ihrem Buch "Splitterfasernackt" in starke, gnadenlos offene Worte gefasst hat. Lillys Kindheit endet, als sie sechs Jahre alt ist. Ein Nachbar vergewaltigt sie, immer wieder. Doch Lilly erzählt niemandem davon. Sie zieht sich zurück, tief traumatisiert. Ihre Eltern verstehen sie nicht, das schwierige Kind geht ihnen auf die Nerven. Der Nachbar zieht weg, aber die Verzweiflung bleibt. Lilly fängt an zu hungern und sich Muster in den Arm zu ritzen. Als sie 17 ist, wird sie erneut brutal vergewaltigt, mit 20 entschließt sie sich zur Flucht nach vorn: Lilly wird Prostituierte. Sie professionalisiert den Sex, der ihr so viel Angst macht. Sie übernimmt wieder die Kontrolle über ihren Körper und lässt sich gut dafür bezahlen.
"Splitterfasernackt" ist keine leichte Lektüre. Oft ist sie kaum zu ertragen. Sie werden womöglich weinen. Sie werden Lilly Lindner in den Arm nehmen wollen. Sie werden wütend sein, auf die Verbrecher und die Gesellschaft, die ihre Kinder nicht schützen kann. Und trotzdem werden Sie weiter lesen, gefesselt von der Sprache dieser Frau und ihrem scharfen Verstand. Die so präzise und nachfühlbar beschreibt, was Gewalt anrichtet und warum sie so oft in Schweigen endet. Gut, dass Lilly Lindner ihr Schweigen gebrochen hat.Michèle Rothenberg
Leseprobe
image
PROLOG
Vielleicht arbeite ich ja nur deshalb in einem Bordell, weil Männer an einem Ort wie diesem für ihre Triebe bezahlen müssen und weil sie auf diesem Weg nicht einmal annähernd zu meinem Herzen durchdringen können. Sie sind nur ein flüchtiger Schwarm zirpender Wanderheuschrecken. Ein Rudel schwanzwedelnder Hunde.
Es gibt Männer, die stellen ihre Frau vor dem Baumarkt ab und sagen: "Schatzi-Mausi, ich gehe nur schnell ein paar Dübel kaufen ... wartest du bitte kurz hier auf mich - im Baumarkt langweilst du dich ja sowieso bloß ..." Und dann verlassen diese Männer den Baumarkt durch den Zugang um die Ecke und gehen auf einen Zehn-Minuten-Fick in ein Bordell. Für solche Notfälle haben Männer sogar immer eine ungeöffnete Packung Dübel oder Schrauben als Alibi in der Tasche. Das ist die Welt, in der ich meine zu kurzen Röcke und mein gefälschtes Lächeln trage.
Warum sollte ich je wieder Sex haben, ohne dafür bezahlt zu werden? Aus Liebe? Nein danke. Nicht einmal mit Rückgaberecht. Das ist viel zu kompliziert. Und die Miete lässt sich davon auch nicht bezahlen.
Das habe ich nur so dahingeschrieben. Eigentlich meine ich das Gegenteil. Was kann schöner sein als der erste Kuss oder ein ehrlich gemeintes Lächeln. Was ist wertvoller als geschenkte Zeit und eine liebevolle Berührung.
Es gibt Augenblicke, in denen ich mich frage: "Wie konnte ich es nur wagen, meinen Körper gegen die Sucht, in fremde Arme zu fallen, einzutauschen? Und mit welchen Worten kann ich ihn wieder in Empfang nehmen, falls ich ihn eines Tages zurückbekommen sollte?" Es ist ein Alptraum, dieses Spiel mit einem geschändeten Körper zu treiben.
Den schlimmsten Sex im Leben kann man nur einmal haben.
Wenn ich Sex auf dem goldenen Himmelbett in Zimmer vier habe, starre ich verloren den orangegelben Leuchtschlauch an. Ich sehe Licht, denke ich mit meinen ausgebrannten Gehirnzellen und verharre regungslos im Nichts. Ich fühle einen Körper auf mir - gut, wenn er nicht verschwitzt und klebrig ist. Schlecht, wenn er es doch ist. Ich schlinge meine verzweifelten Arme um einen Kunden, wenn ich ihn mag. Ich lasse meine Arme schlaff auf dem Bettlaken verweilen, wenn ich ihn nicht mag. Ein unbedeutendes Stöhnen an meinem Ohr, eine Wange ganz dicht an meiner. Wenn ich meinen Gast nett finde, ist es okay, wenn nicht, bin ich woanders.
Den schlimmsten Sex im Leben kann man nur einmal haben. Und ich habe ihn längst hinter mir. Damals... Mit jedem Tag bin ich weiter weg davon.
Es sind meine Masken, die einen Teil von dem aufgewühlten Sturm in mir verraten: An leuchtenden Tagen bin ich die beste Liebhaberin, die man sich zu gönnen wagt; an dunklen Tagen bin ich die geilste Nutte, die man kaufen kann.
Meine Sätze sind unruhig. Zwischen den Zeilen wandern ungreifbare Gedanken hin und her. Ich versuche, ein paar Kommas zu verschieben, die hässlichen Wörter gegen schönere auszutauschen. Aber ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr.
Ich reiße Männer auf. Und Kondomverpackungen. Ich reiße und reiße, und alles zerbricht. Vielleicht sollte ich davonrennen und mich in einem nachtschwarzen Wald vor mir selbst verstecken. Dort könnte ich tagelang keinen Sex haben - ich würde vergessen, wie ein Schwanz schmeckt, ich würde aufhören, den kleinsten gemeinsamen Nenner von mir und mir und mir zu suchen. Es würde anfangen zu regnen. Und ich würde dort an einem wunderschönen verlassenen See sitzen, und der Regen würde leise flüsternd die Schande von meinem Körper tragen.
VORSPIEL
Der erste Mann, mit dem ich Sex habe, riecht nach Alkohol und kaltem Zigarettenrauch. Seine Hände sind rau und klebrig, seine Haare ungepflegt, und von seinem Atem wird mir zuerst schlecht, dann schwindlig. Er wirft mich auf ein Sofa mit altmodischem Blumenmuster und hält mich mit seiner einen Hand fest, während die andere an seinem Gürtel herumfummelt. Ich weine. Ich sage irgendwelche bittenden Worte, ich stammle zusammenhanglose Sätze, ich flehe ihn an, ich flüstere nein, nein. Nein.
Meine Stimme fühlt sich fremd an, sie stolpert über meine viel zu trockenen Lippen. Ich versuche sie zu halten, denn wenn ich sie verliere, dann verliere ich auch mich.
Aber der Mann schlägt mir ins Gesicht, und ich sehe zu, wie mein rechter Schneidezahn durch die Luft fliegt und unter dem Couchtisch verschwindet. Es ist ein Milchzahn. Alles ist okay. Ich werde einen neuen bekommen. Wie weich meine Gedanken sich anfühlen, wie sanft. Obwohl ich schreie.
"Hör auf zu heulen!", schnauzt der Mann mich an und presst seine Hand auf meinen blutenden Mund. "Wenn du noch einmal schreist, dann schlitze ich dich auf!" Also schreie ich nicht mehr. Ich bin ganz still. Aber er schlitzt mich trotzdem auf. Er bohrt sich in mich, er liegt schwer und keuchend auf mir. Seine linke Hand schließt sich wie ein Schraubstock um meinen Hals, die rechte reißt grob an meinen Haaren.
Vertrauen. Ein Fehler, den ich nicht wieder begehe.
"Schlampe", raunt er mir ins Ohr, "du kleine dreckige Schlampe!" Ich starre die gelbweiße Zimmerdecke an. Sie kommt mir blendend grell vor. Meine Arme liegen schlaff neben mir, ich will sie bewegen, aber sie gehorchen mir nicht mehr. Mein Kopf ist leer und voll von Rauschen. Ich erzähle mir eine Geschichte, die ein schönes Ende hat, aber ich höre kaum zu. "Komm", wispert mir da eine leise Stimme ins Ohr; die Stimme gehört mir, aber ich erkenne sie nicht. "Komm", flüstert sie, "ich bringe dich weg von hier, vertrau mir."
Vertrauen. Ein Fehler, den ich nicht wieder begehe. Vertrauen ist russisches Roulette ohne Gewinner. Vertrauen ist ein mit Leichen bedecktes Kinderkarussell. Aber in einem Moment wie diesem, wenn die Entscheidungen, die man trifft, nichts mehr verändern, ist es okay, nach Strohhalmen zu greifen. Also vertraue ich der Stimme doch. Schweigend nehme ich ihre Hand an und lasse mich fortführen. Weg von dem Sofa, weg von dem Mann, weg von meinem Körper. In der hintersten Zimmerecke bleibt das kleine Mädchen schließlich stehen, seine kalte Berührung umschließt mein wimmerndes Herz.
"Weiter weg können wir nicht gehen", flüstert es kaum hörbar. Ich drehe mich um und blicke auf meine hilflose Hülle. Ich sehe in meine leeren Augen, betrachte die bleichen dünnen Beine, die merkwürdig verkrümmt zur Seite ragen. Ich nehme Abschied von dem geschädigten Körper. Er gehört nicht mehr mir. Die Trennung ist leicht, alles andere wäre schwerer. "Mach die Augen zu", flüstert da die Stimme. "Mach sie erst wieder auf, wenn ich es dir erlaube." Ich gehorche ihr. Keine Sekunde wage ich zu zögern. Ich blende ihn aus, meinen Körper, das tote Stück Fleisch; ich lasse ihn allein, ich lasse ihn zurück. Ich gebe ihn auf.
Der Schmutz, der an mir klebt, darf niemals zu sehen sein.
Der Mann lässt uns gehen. Mich und den Körper. Wir stehen vor seiner Wohnungstür, er drückt uns eine Tafel Schokolade in die Hand und sagt: "Das ist unser kleines Geheimnis. Du wirst es niemals jemandem erzählen. Hörst du? Niemals! Wenn dir dein Leben lieb ist ..." Mein Leben ist mir nicht mehr lieb. Ich weiß gar nicht so genau, was Leben eigentlich noch bedeutet. Ich habe es vergessen. Aber der Mann schließt seine Tür und wartet keine Antwort ab.
Da stehen wir dann, der Körper und ich. Schweigend, stumm. Jetzt ist es zu spät, um wegzulaufen. Wir verharren. Wir warten ab. Wir lauschen angespannt in den dumpfen Nachhall. Aber nichts passiert. Nichts wird leichter. Der Schmerz fühlt sich taub an. Fremd. Unbekannt. Ist das überhaupt mein Schmerz? Vielleicht gehört er ja jemand anderem. Wie überschaubar wäre das.
Ich beschließe, kein Wort zu verlieren über meine Schande, die ich hinter dieser Tür besiegelt habe. Dazu sind Türen da, um sie geschlossen zu halten, wenn man weiß, dass dahinter ein Mann mit einem gewetzten Messer lauert. Also gehe ich einen Schritt zurück. Weg von der Tür. Geheimnisse müssen bewahrt werden, Dunkelheit sollte man nicht ans Tageslicht ziehen. Der Schmutz, der an mir klebt, darf niemals zu sehen sein. Es ist ein Spiel. Verstecken. Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? Keiner. Und wenn er kommt? Dann kommt er halt. Und wenn er da war, was dann? Wenn er drinnen war, was dann?
Dem Körper ist das alles egal, er steht nur nutzlos herum. Ich verachte ihn für seine Schwäche. Wie könnte er zu mir gehören? Das bin ich nicht. Lautlos trete ich einen weiteren Schritt von der Tür zurück. Der Körper bewegt seine müden Beine und folgt mir.
"Bleib stehen", sage ich. Aber er kommt näher. Da drehe ich mich um und renne fort.
Meine Eltern brauchen ein perfektes Kind; ich muss funktionieren.
Ich bin sechs Jahre alt, bald komme ich in die Schule. Glücklich sein ist wichtiger als Schmerzen empfinden, das habe ich schon im Kindergarten gelernt. Denn Eltern mögen glückliche Kinder. Eltern mögen lachende Kinder. Wenn man lächelt, mit Grübchen in den Wangen und mit leuchtenden Augen, wenn man lange, vom Wind zerzauste Haare und ein süßes Puppengesicht hat, dann wird man leichter geliebt als andere. Perfektion ist Sicherheit, Perfektion ist Macht. Meine Eltern brauchen ein perfektes Kind; ich muss funktionieren, ich darf auf keinen Fall ein Fehler sein. Also schrubbe ich stundenlang in der Badewanne zwischen meinen Beinen hin und her, bis die Haut rot und geschwollen ist. Mit gleichgültigen Augen betrachte ich dabei das blutige Wasser, es wird verschwinden, sobald ich die Wanne leerlaufen lasse, so weit, so gut. Nichts bleibt zurück.
Nach dem Baden wickele ich mich in das größte Handtuch, das ich finden kann, und bin verzweifelt, weil es nicht weiß ist, denn weiß ist beruhigend, weiß ist sauber, weiß ist rein. Meine Beine sind wacklig, sie fühlen sich fiebrig an, heiß und kalt zugleich, bei jeder Bewegung schwankend. Aber ich darf nicht fallen, nicht heute, die neunzehn Schritte bis in mein Zimmer muss ich schaffen. Ich zähle sie, jeden einzelnen. Und ich schaffe sie, alle.
In meinem Zimmer vergrabe ich mein Gesicht in dem nach Waschmittel duftenden Handtuch. Ich verschwinde darin und frage mich, ob ich mich unsichtbar machen kann, wenn ich nur fest genug daran glaube. Ich glaube, so sehr ich kann. Aber nichts passiert.
Also nehme ich die Schokolade, die ich achtlos zusammen mit meinem Kleid auf den Fußboden geworfen habe, und esse sie hastig auf. Dann gehe ich wie in Trance zurück ins Badezimmer, die schwachen Beine taumelnd wie die einer Marionette; dort beuge ich mich über die Toilette und würge so lange, bis auch der letzte Krümel wieder aus dem elenden Körper heraus ist. Anschließend wasche ich mir meine Hände und das Gesicht mit eiskaltem Wasser und sehe dabei zu, wie sie erst blau und dann violett-lila anlaufen. Der Schmerz beruhigt mich, ich fühle, wie meine Fingerspitzen langsam taub werden, wie sie zittern und beben. Es ist nichts passiert. Es ist doch nichts passiert.
Mit verkrampften Händen drehe ich den Wasserhahn wieder zu und blicke auf. Mein Spiegelbild weicht einen Schritt zurück von mir. Und dann noch einen. Und noch einen. Da weiß ich genau: Es gibt mich nicht mehr.
Man kann mir noch so oft sagen, dass ich mich für nichts schämen muss. Ich glaube kein Wort.
Die Tatsache, dass ein gewöhnlicher Tag in meinem Leben nicht damit beginnt, dass jemand die Bettdecke von meinem Körper reißt, zu mir aufs Bett gesprungen kommt und in mein Ohr brüllt: "Hey, aufwachen! Erzähl die Geschichte! Wie war das, als du vergewaltigt worden bist?!" - diese Tatsache kommt meinem Geisteszustand sehr gelegen.
Noch heute fällt es mir schwer, "Vergewaltigung" zu sagen, ohne dabei mit fahrigen Händen durch meine Haare zu streichen, auf meiner Lippe herumzukauen oder zu Boden zu blicken. Ich habe niemals einem Menschen in die Augen gesehen, während ich davon erzählt habe. Und man kann mir noch so oft sagen, dass ich mich für nichts schämen muss, dass ich unschuldig bin. Ich glaube kein Wort, bis ich unwiderlegbare Beweise dafür habe. Und wer soll mir die liefern?
"Vergewaltigung" in den Laptop zu tippen ist leichter, als es auszusprechen. Aber die nackten Buchstaben anschließend auf dem Bildschirm lesen zu müssen ist ein unerbittliches Aufbegehren gegen mich selbst.
Ich weiß nicht mehr, wann ich zum ersten Mal darüber geschrieben habe, vielleicht, als ich vierzehn Jahre alt war, vielleicht auch erst mit fünfzehn. Solange ich es nicht aufgeschrieben hatte, war es weniger wirklich, weiter weg von mir. Aber man kann sich nicht ewig belügen; irgendwann fängt man doch an, sich hübsche Muster in die Arme zu schlitzen. Und wenn nichts mehr von dem ersten Arm übrig ist, geht man entweder erbarmungslos zu dem zweiten Arm über, oder man beginnt sich allmählich ein paar Gedanken zu machen. Mein Gehirn macht sich sehr gerne Gedanken. Und es ist zu dem Schluss gekommen, dass ich all die Erinnerungen, die nach und nach in mir aufkommen, zu Papier bringen sollte, um sie zu ordnen und um später sagen zu können: "Okay, das kenne ich schon! Ich weiß, dass er das mit mir gemacht hat, ich habe es sogar aufgeschrieben. Es ist vorbei. Einmal durchdrehen reicht vollkommen aus."
Aber es hat natürlich nicht gereicht. Und es wird niemals reichen.