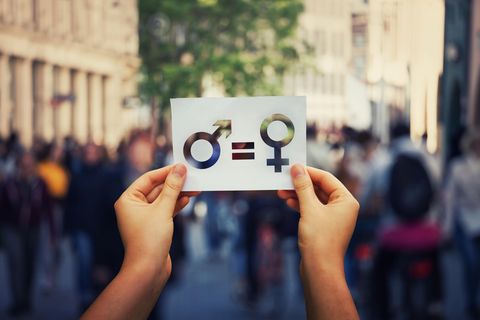"Wir kommen weit her, liebes Kind und müssen weit gehen. Keine Angst, alle sind bei dir, die vor dir waren" und die noch kommen werden, mit diesem Gedichtauszug von Heinrich Böll endet das Videogespräch mit Christa Nickels.
Ich bleibe in einer nachdenklichen Stimmung zurück, ordne meine Notizen und speichere die Aufnahme auf meinem Diktiergerät. Ich bin eine dieser jungen Frauen, die auf dem Fundament derer laufen lernte, die sich während ihres Kampfes Spott und Beleidigungen aussetzten, um etwas zu verändern. Eines wird mir deutlich: Stillstand ist keine Option, wir haben den Staffelstab übernommen und müssen jetzt unseren Beitrag leisten.
In den vergangenen 16 Jahren hatten wir mit Angela Merkel eine Bundeskanzlerin. Für viele ist dieser Fakt der ultimative Beweis dafür, dass ein Kampf für mehr Gleichberechtigung nicht mehr nötig sei. Doch gerade in Krisensituationen wie der Pandemie zeigt sich eines ganz deutlich: Das Fundament, welches durch Polit-Pionierinnen geschaffen wurde, bekommt schnell Risse und lastet wieder hauptsächlich auf den Schultern der Frauen. Für Christa Nickels ist das beschämend.
Christa Nickels ist eine der Polit-Pionierinnen, die für die Rechte der Frau kämpfte
Brigitte: Frau Nickels, sind wir in Sachen Gleichberechtigung auf einem guten Weg?
Christa Nickels: Es hat sich bereits viel zum Positiven geändert. Aber unendlich viel bleibt zu tun. So ist es heutzutage noch immer so, dass der gefährlichste Ort für Frauen leider in der Familie liegt – auch wenn das mittlerweile ein gesellschaftliches Thema geworden ist. Aber gerade jetzt zeigen die aktuellen Erfahrungen aus der Pandemie mit ihren Lockdowns, wie erbärmlich brüchig das ganze Netz von Kinderbetreuung, Schule und sozialen Hilfen immer noch ist.
In einem Interview sagten Sie einmal, dass Frauen noch immer zu sehr zurück- und nicht so sehr für sich und Ihre Forderungen einstehen. Woran sollten wir als Frauen da noch arbeiten?
Das Problem ist, dass viele junge Frauen meinen, dass wir die Gleichberechtigung doch schon längst erreicht haben. Dass dem nicht so ist, zeigt sich häufig erst dann, wenn die Familienplanung ansteht, da schnappt die "Mütterfalle" gnadenlos zu. Doch dann ist es zu spät, die Erkenntnis hätte es vorher gebraucht. Wir müssen energisch an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie arbeiten.
Als Sie in die Politik gingen, waren sie Mutter von zwei kleinen Kindern. Wie sah das bei Ihnen aus?
Ich war damals eine junge Frau von 25 Jahren und hatte zwei kleine Kindergartenkinder. Ich war auf einer internistischen Intensivstation als Nachtwache beschäftigt. Damals konnte man nur qualifiziert Teilzeit arbeiten, wenn man im Nachtdienst tätig war. Das gab mir allerdings auch die Möglichkeit, tagsüber für meine Kinder da zu sein und außerdem den Zeitraum, mich politisch zu engagieren – was im Wechselschichtdienst nicht möglich gewesen wäre.
Was war Ihr Anspruch, als Sie in die Politik gegangen sind?
Man hatte das Gefühl, dass all das, was der damaligen etablierten Politik nicht passte, von den Parlamenten wie von einer Gummiwand abprallte. Ich war sehr begeistert von dem Anspruch, dass Demokratie eben bedeutet, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich mit einbringen und auch mitgestalten können. Und als ich merkte, dass genau das an den verhärteten Strukturen scheitert, sah ich mich angetrieben, dagegen etwas zu unternehmen. Und da war ich ja nicht allein. Es war die Zeit der großen zivilgesellschaftlichen Initiativen: der Frauenbewegung, der Studentenbewegung, der Umweltbewegung, der Friedensbewegung.
Nachdem Sie zwei Jahre bei den sozialdemokratischen Frauen mitgearbeitet haben, ohne Mitglied zu werden, entschieden Sie sich für die Grünen und wurden in Nordrhein-Westfalen sogar zu einem Gründungsmitglied der Partei. Gab es den Anspruch der Gleichberechtigung bei den Grünen schon immer?
Da die Frauenbewegung eine unserer Gründungsströmungen war, war das natürlich ein ganz wichtiger Grundsatz, der auch breit akzeptiert wurde. Und wir sind dann ja auch 1983 fast paritätisch in den Bundestag eingezogen. Damit war der Frauenanteil im Bundestag wieder zweistellig – nur ganz knapp über dem Anteil von 1919. Wenn man sich das mal vorstellt, war das eigentlich eine ziemliche Blamage, so viele Jahrzehnte später.
Wie haben Sie versucht, die Position der Frauen innerhalb der Partei zu stärken?
Da musste auch noch so einiges an Pionierarbeit geleistet werden. Ich habe damals engagiert daran mitgewirkt, in den Grünen Landesverbänden große Frauenversammlung abzuhalten, wo wir uns zu allen frauenpolitisch relevanten Themen austauschten und Durchsetzungsstrategien erarbeiteten. Wir haben die Mindestquotierung aller Ämter und Mandate in unserer Parteisatzung durchgekämpft, was bedeutet, dass die ungeraden Listenplätze an Frauen gehen und damit sichergestellt ist, dass mindestens die Hälfte der Ämter und Mandate von Frauen besetzt werden. Das ist uns alles nicht in den Schoß gefallen, sondern musste hart erkämpft werden. Von anderen Parteien und der Öffentlichkeit gab es anfangs Spott und Hohn nach dem Motto: Das seien ja nur Quotenfrauen.
Wie haben Sie diesen Gegenwind damals wahrgenommen?
Wir haben die Partei ja nicht aus Langeweile gegründet. Fast jede von uns hatte sich vorher schon bei anderen Parteien umgesehen und nicht das Passende gefunden. Unsere Frustrationsgrenze war schon sehr hoch mittlerweile und wir hatten ein dickes Fell. Wir machten uns keine Illusionen und waren absolut gewillt, dadurch zu gehen.
In der Dokumentation wird Ihre Rede bei der Rüstungsdebatte gezeigt, bei der Sie anschließend Bundeskanzler Helmut Kohl einen Kranz aus 1000 Kranichen überreichten.
Ja, das waren Origami-Kraniche. Der Kranich ist in Japan das Zeichen für ein langes Leben und Heilung. Diese Kranich-Ketten wurden damals von den Strahlenkranken der Hiroshima-Katastrophe gemacht in der Hoffnung zu überleben. Die Kette, die ich während der Rüstungsdebatte überreicht habe, wurde mir von Friedenaktivisten übergeben, um sie mit in die Diskussion einzubringen. Ich war 1982 selbst in Hiroshima, habe Langzeitüberlebende in Pflegeheimen besucht und bin mit Professor Moritaki, der als Kind den Abwurf der Atombombe überlebt hatte, durch die Stadt gegangen und habe so den Horror der Atombombenexplosion in herzbewegender Weise erfahren.
Wie haben die Abgeordneten auf Ihre Rede reagiert?
Ganz zu Beginn wurde gelacht und gepöbelt, aber mit jedem weiteren Wort wurde es ruhiger. Die "Zeit" hat damals auf der Titelseite den Leitartikel gebracht: "Die Kette der 1000 Kraniche" und hat sinngemäß geschrieben: "Es gab einen Augenblick, wo der Kanzler Risse in seiner Panzerung zeigte, als Christa Nickels sprach und ihm anschließend die Kette überreichte". Und das war tatsächlich so. Das war für mich ein sehr intensives Erlebnis.
War diese Rede nicht etwas unkonventionell?
Ja, die Übergabe der Kette war ein völlig unübliches Stilmittel. Mir war wichtig, die Würde des Hauses zu bewahren, aber trotzdem das einzubringen, was die Menschen auf der Straße umtrieb. Das ist ja auch das Besondere, was Thorsten Körner mit der Dokumentation eingefangen hat: In besonderer Weise waren und sind es oft auch heute noch Frauen, die über den Schatten der Konventionen springen und sich trauen, etwas Unerhörtes zu sagen. Und das war in allen Bereichen der Fall, zum Beispiel auch bei dem Thema Vergewaltigung in der Ehe und Verhütung, wo der Kollege Detlef Kleinert kommentierte: Im Bundestag hätte das nichts zu suchen, das sei was Privates. Aber das Private ist politisch.
Damit sprechen Sie auf die Rede von Waltraud Schoppe an, die in einem sehr sachlichen Ton über die Themen sprach, die die Männerwelt zum Kochen brachten. Sie wünschte sich in dieser Rede einen Kanzler, mit dem man sich über Themen wie Verhütung unterhalten könne. Mit dem schönen Nebensatz, wenn er sich denn damit auskennen würde.
Ja, gerade Kollegen auf der Seite der CDU/CSU waren außer Rand und Band und überzogen das Plenum mit einem obszönen, widerwärtigen Klangteppich. Dabei hat Waltraut Schoppe schlicht und ergreifend gesagt, es sei absolut notwendig, dass Männer und Frauen die Verantwortung für Schwangerschaft, Kindererziehung und das Familienleben gleichermaßen übernehmen.
Warum war es für Sie wichtig, Teil der Dokumentation zu werden?
Ich war erst sehr skeptisch, weil ich es genossen habe, nun im Alter frei von öffentlichem Interesse nach meiner Fasson leben zu können. Ich habe dann aber doch die große Chance gesehen, dass mit diesem Film zum ersten Mal gezeigt wird, welchen Beitrag zur Demokratie Politikerinnen aller Parteien der Bonner Republik in der Nachkriegsära geleistet haben. Ich bin sicher, dass dieser Film das Wurzelwerk der Demokratie stärkt.